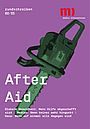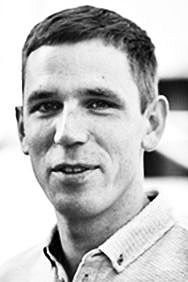
Teil des Heftes schreibt er über russische und ukrainische Kriegsdienstverweigerer.
Liebe Leser:innen,
„Beyond Aid“ lautete der Titel einer internationalen Hilfe-Konferenz, die medico 2014 in Frankfurt veranstaltete. Im Ankündigungstext hieß es an zentraler Stelle: „Wie lässt sich verhindern, dass die Idee globaler Verantwortung zur Legitimation machtpolitisch motivierter Interventionen verkommt? Was ist erforderlich, um die Universalität der Menschenrechte nicht einfach nur zu konstatieren, sondern für alle zu verwirklichen?“ Das liest und fühlt sich heute nach guten alten Zeiten an. Und es ist beinahe erschreckend, wie viel Optimismus vor mehr als zehn Jahren einer schon damals in der NGO-Welt eher für ihren kritischen, teils illusionslosen Ton bekannten Organisation möglich war, ohne dabei aus ihrer Rolle zu fallen. Doch wie man „von der Wohltätigkeit zur Solidarität“, so der Untertitel der Konferenz, kommt, war damals eine völlig angemessene Frage für eine Frankfurter „Hilfsorganisation des organisierten Pessimismus“, in der wohl alle ihren Adorno gelesen hatten.
Adorno muss man heute für vieles nicht mehr lesen. Es reicht ein Blick in die Zeitung. Das auch im Rahmen der Konferenz immer wieder bemühte alte medico-Credo „Hilfe verteidigen, kritisieren, überwinden“, das Ausdruck der Idee des Fortschritts der Demokratie, angewandt auf den Alltag einer NGO war, hat sich nicht zuletzt in den letzten Monaten auf die Notwendigkeit reduziert, die Hilfe vor ihrer Abschaffung oder dramatischen Einschränkung zu verteidigen. Denn ein großer Teil der herrschenden Eliten des Westens hat sich darauf verständigt, bestimmte unverwirklichte Ideale nur noch für sich geltend zu machen, für alle anderen aber zu entsorgen – und mit ihnen die sich zumindest in Hilfsprogrammen ausdrückende Verantwortung für die Welt.
„After Aid“: Das ist daher zwar nicht der Titel einer weiteren medico-Konferenz, steht aber auf dem Titel dieses rundschreibens. Wir meinen das keinesfalls als Abgesang, sind jedoch überzeugt, dass auch für die Hilfe und ihre Akteure eine neue Zeit mit neuen Fragen angebrochen ist. Dass Hilfe nicht nur unter Beschuss steht, sondern ihre Mechanismen auch Teil des Beschusses sein können, darüber berichtet Riad Othman in seinem Leitartikel. Er kritisiert die fast vollständige israelische Kontrolle über die Hilfslieferungen nach Gaza, in deren Folge die dortige Bevölkerung seit Monaten systematisch ausgehungert wird. Er fragt aber auch, ob Hilfe allein eine Antwort sein kann. medico-Kollege Felix Litschauer schreibt in seinem Bericht von der Weltgesundheitsversammlung über die dramatische Lage der WHO, der auch mit dem neuerlichen Rückzug der USA zu tun hat. Mark Heywood erklärt im Gespräch am Beispiel der südafrikanischen HIV-Bekämpfung, welche dramatischen Folgen sich aus dem neuen Kurs der USA und des Westens allgemein ergeben. Im hinteren Teil des Heftes schreibt die ZEIT-Journalistin Andrea Böhm, wie diese Prozesse auch in der Auslandsberichterstattung und einem Wandel des Journalismus widerhallen. Der Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, den sie im Mai auf dem Symposium der medico-Stiftung hielt.
In den letzten Monaten haben Leute wie Donald Trump nicht nur mit äußerster Brutalität gehandelt. Paradoxerweise waren sie auch dafür verantwortlich, dass die Frage des Friedens wieder Teil der Debatte um die großen Kriege dieser Zeit wurde. Waren die Inszenierungen als Friedensstifter und die imperiale Zurechtweisung der Ukraine weder glaubwürdig noch sympathisch, so haben sie dennoch dazu beigetragen, dass an manchen kriegsbegeisterten Orten ein langsames Umdenken stattzufinden scheint – ob über die bedingungslose Unterstützung Israels oder die einzig auf einen militärischen Sieg enggeführte Ukraine-Strategie des Westens. Die Ergebnisse sind abzuwarten, aber da Waffenproduktion, -export und Aufrüstung weitergehen, bleiben wir skeptisch.
Dennoch dreht sich unser zweiter Schwerpunkt des Heftes um die paradoxen Bedingungen, unter denen Frieden auch heute möglich werden kann. Während Anita Starosta aktuelle Entwicklungen in Syrien beleuchtet und die Kolleg:innen von UMAM auf Geschichte und Gegenwart des libanesischen Bürgerkrieges blicken, diskutiert der türkische Jurist und Politiker Mithat Sancar die Aussichten eines türkisch-kurdischen Friedensprozesses, der mit der Auflösung der PKK eingeleitet ist.
In diesem Heft sind wieder viele, aber bei weitem nicht nur schlechte Nachrichten versammelt. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr Mario Neumann