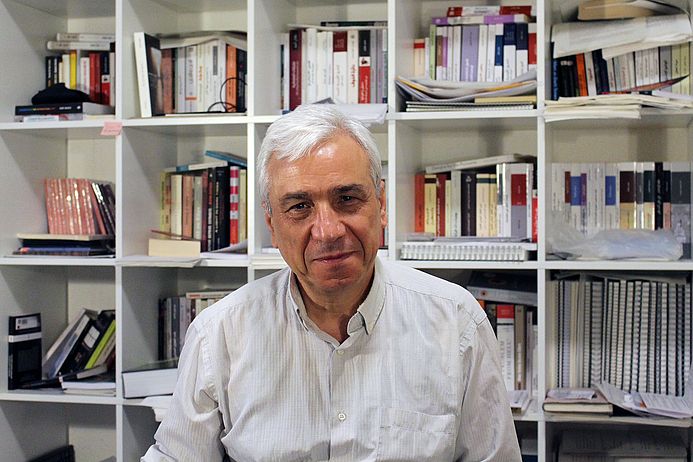medico: Wie blickst du auf die jüngste Angriffswelle auf drusische Gemeinschaften im Süden Syriens?
Yassin al-Haj Saleh: Dieser Gewalt liegt ein strukturelles Problem zugrunde. Syrien ist eine sehr vielfältige Gesellschaft, aber die politische Macht hat diese Vielfalt nie widergespiegelt. Historisch gesehen hatten wir ein System, das von einer Einheitspartei dominiert wurde, die zu einem familiären und konfessionellen Regime geworden ist. Heute kontrolliert eine andere Gemeinschaft, die der Sunnit:innen, die Macht, aber der Staat repräsentiert weiterhin nicht das gesamte Volk. Man kann das Land nicht stabilisieren, wenn dieses Ungleichgewicht bestehen bleibt. Solange der Staat sein Monopol aufrechterhält, ohne inklusiv zu sein, werden die Spannungen anhalten. Die Gewaltausbrüche an der Küste im März gegen Alawit:innen und die jüngsten Übergriffe gegen die drusische Minderheit sind Symptome dafür. Sie bieten auch Mächten wie Israel einen Vorwand, um unter dem Deckmantel des Schutzes bestimmter Gemeinschaften zu intervenieren. Als Syrer:innen müssen wir zuerst vor unserer eigenen Haustür kehren. Ich mache daher die derzeitige Regierung für die anhaltende Instabilität verantwortlich.
Will die neue Regierung ein exklusives Monopol durchsetzen, das auf ideologischen oder religiösen Überlegungen fußt?
Das Hauptproblem ist ihr Drang, die Macht in ihren Händen zu konzentrieren. Das ist eine politische Entscheidung, nicht nur eine Frage des religiösen Glaubens. Der Präsident trägt einen Teil der Verantwortung: Entweder kann er nicht handeln, und dann braucht es jemand anderen, oder er weigert sich zu handeln, was noch schlimmer ist. Es ist an der Zeit, diese Zentralisierung in den Händen einer einzigen Gruppe zu beenden. Wir haben für eine Demokratie gekämpft, die alle Teile der Gesellschaft einbezieht. Wir haben nicht gegen ein exklusives Regime gekämpft, um dann ein anderes zu akzeptieren. Die Sunnit:innen sind zahlenmäßig in der Mehrheit, aber politisch bedeutet das nichts: Sie sind zu vielfältig und zu gespalten, um einen homogenen Block zu bilden. Und selbst wenn sie sich zusammenschließen würden, würde dies niemals den Ausschluss der Alawit:innen, Drus:innen, Kurd:innen, Christ:innen und anderer Minderheiten rechtfertigen. Zusammen machen sie ein Drittel der Bevölkerung aus. In einer so pluralistischen Gesellschaft kann Ausgrenzung einfach nicht funktionieren. Das System muss diese Vielfalt widerspiegeln.
In Suweida waren Regierungstruppen zum zweiten Mal in Verbrechen gegen Zivilist:innen verwickelt, obwohl sie eigentlich für die Wiederherstellung der Ordnung zuständig sind.
Die neue Regierung hat es nicht geschafft, die Bevölkerung zu einen. Sie hat ihre Unterstützung nicht verbreitern können und sogar moderate oder kritische Stimmen verloren, die ihr wohlgesonnen waren. Selbst wenn das, was insbesondere in der Region Latakia geschehen ist, Folge eines Fehler oder eines Moments der Panik gewesen wäre, bleibt es in den Augen vieler unverzeihlich. Über die vernichtende Gewalt hinaus handelt es sich um demütigende Handlungen, die sich gegen Gemeinschaften richten, weil sie sind, was sie sind, und nicht wegen etwas, das sie getan haben. Ganze Familien wurden massakriert. Das ist kein Zufall: Man begeht nicht zweimal innerhalb von vier Monaten dieselben Gräueltaten, ohne dass dies systemisch geschieht.
Warum hat der Staat diese Verbrechen in seinen eigenen Reihen nicht verhindert?
Die neue Regierung befindet sich in der schwächsten Position seit ihrer Machtübernahme. Entweder hat sie keine Kontrolle über die bewaffneten Gruppen, was alarmierend wäre, oder sie hat Kontrolle über sie, was noch gravierender wäre. Sie hat an Glaubwürdigkeit verloren, ihre Popularität ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Die politische Niederlage wurde schlecht gehandhabt. Zudem wurde sie verschärft durch den Druck von außen: durch die Vereinigten Staaten, die Türkei, die arabischen Länder und die Verbrechen der eigenen Streitkräfte sowie durch die israelische Regierung, die Völkermord in Gaza begeht und in Syrien interveniert, um die Spaltungen zu vertiefen und das Land weiter zu schwächen. Darüber hinaus hat die Kommission, die mit der Untersuchung der Massaker an der Küste beauftragt ist, ihre Ergebnisse nicht veröffentlicht. Indem das Regime Untersuchungen verspricht, aber keine konkreten Ergebnisse liefert, verstärkt es nur seinen Legitimitätsverlust. Das Schweigen und das Ausbleiben von Gerechtigkeit schürten die Wut.
Du hast einmal gesagt, die lange Diskriminierung und Unterdrückung der Sunnit:innen unter Assad habe zu einer Selbstwahrnehmung als Opfer geführt. Was hat das mit den Massakern im März zu tun?
Das Gefühl der Viktimisierung ist bei vielen Sunnit:innen tief verwurzelt. Tatsächlich wurden sie diskriminiert. Die Chemiewaffenangriffe und die Fassbomben richteten sich vor allem gegen ihre Gemeinschaften. Diese Erfahrungen nähren auch den sunnitischen Islamismus, sei es in Form von Dschihadismus oder einer diffuseren Radikalisierung. Denn die Opferrolle wird nicht nur gelebt, sondern auch erzählt, strukturiert und von Ideolog:innen in mächtige Identitätserzählungen verwandelt. Dieser Diskurs hat sich nach der Revolution verstärkt und verleiht der erlittenen Gewalt eine nahezu ewige Bedeutung. Viele sunnitische Kräfte haben sowohl einen Opferdiskurs („Wir wurden massakriert, diskriminiert, gefoltert“) als auch einen Diskurs der Vorherrschaft („Wir sind die wahren Muslime, die Träger der wahren Botschaft“) entwickelt. Diese beiden Narrative nähren sich gegenseitig und vermitteln letztlich ein Gefühl der Berechtigung zur Herrschaft. Die jüngsten Massaker sind auch auf einen Konflikt der Erinnerungen zurückzuführen. Als im März sunnitische und islamistische Gruppen alawitische Gemeinschaften angriffen, bezogen sich manche auf weit zurückliegende Geschehnisse. Die Alawit:innen ihrerseits haben ihre eigenen Erinnerungen an Diskriminierung und Unterdrückung vor dem Assad-Regime. Heute sind diese Opfererzählungen wie vergrabene Minen: Sie prägen Identitäten, spalten und rechtfertigen Gewalt. Nur wenige versuchen, Brücken zwischen diesen Erinnerungen zu schlagen, um anderen zu helfen, die Muster zu überwinden. Und leider verschließt sich jede Gemeinschaft in der Leugnung des Leids der anderen. Das ist das wahre Drama Syriens: Niemand kann mehr zwischen den Leiden vermitteln.
Haben die verschiedenen Konflikte ausschließlich religiöse Ursachen?
Nein, das Sektierertum in Syrien beruht nicht auf irrationalem Hass zwischen den Konfessionen. In Wirklichkeit hat es seine Wurzeln in einem System der sozialen Ausgrenzung: Es ist eine Frage der Klasse, der Klientelpolitik und des Zugangs zu Chancen. Was die Menschen empört, ist nicht nur die materielle Armut, sondern das Gefühl der Vernachlässigung, der Unsichtbarkeit und der Verachtung.
Ein Prozess, der deiner Meinung nach vor mehreren Jahrzehnten begann …
Ja, genau. Ab den 1960er-Jahren erhielten Minderheiten, insbesondere die Alawit:innen, dank einer Umverteilung Zugang zum Staatsapparat und zur Armee. Aber die große Mehrheit der alawitischen Gemeinschaft blieb arm und lebte in Dörfern und in den Bergen. Bis Anfang der 2000er-Jahre wurden sie abwertend als „Rifiyin“ („Landbewohner:innen“, „Provinzler:innen“) bezeichnet. Mit der von Baschar al-Assad durchgeführten wirtschaftlichen Liberalisierung änderte sich die Lage. Sie verschärfte die Armut der sunnitischen Volksschichten, nun wurden sie als „Rifiyin“ bezeichnet und ihre politischen Positionen als archaisch angesehen. Es handelt sich um eine Wiederholung in umgekehrter Form. Dieses Phänomen betrifft nicht nur die Sunnit:innen. Jede Gemeinschaft in Syrien, ob Alawit:innen, Kurd:innen, Christ:innen oder Sunnit:innen, pflegt ihre eigene Legende der Opferrolle und Überlegenheit. Das Assad-Regime hat dieses Misstrauen geschürt. In Ermangelung eines echten politischen Lebens und von Parteien ist die syrische Gesellschaft in paranoide Gemeinschaften zerfallen. Paranoia bedeutet jedoch, zu glauben, dass man sowohl Opfer als auch anderen überlegen ist.
Kann sich die Gewalt weiter ausbreiten?
Ich hoffe nicht. Ich stütze mich dabei auf die Tatsache, dass diejenigen, die sie ausgelöst haben, nun wissen, dass sie sich keinen dritten Fehler leisten können. Das Fiasko ist offensichtlich, und jede:r in Syrien ist sich dessen bewusst geworden. Die Zutaten für Gewalt und Zusammenbruch sind aber nach wie vor vorhanden. Es gibt drei große Schwachstellen. Erstens das Erbe Assads: 54 Jahre brutale und zentralisierte Macht, die nach außen hin starr erscheint, aber von innen heraus zerfressen ist. Zweitens keine starken politischen Kräfte und keine gemeinsame Vision, die das Land in eine bessere Zukunft führen könnte. Drittens sind die derzeitigen Machthaber mit zahlreichen Meutereien konfrontiert. Einige sind extremistisch, andere haben Rache im Sinn. Noch besorgniserregender ist das allgemeine Klima: Es gibt keine rationale Debatte und keine klare Analyse mehr. Alles ist sektiererisch, polarisiert und hasserfüllt geworden. Anstatt für ein inklusives politisches System einzutreten, ziehen sich viele auf Brandreden zurück. Die sozialen Netzwerke sind zum Schauplatz eines virtuellen Bürgerkriegs geworden. Selbst die gemäßigten Stimmen, die es hier und da gibt, werden von der Logik der Gewalt und des Überlebens erstickt.
Was bräuchte es stattdessen?
Für einen Wiederaufbau braucht die syrische Gesellschaft Gerechtigkeit, Chancengleichheit, gemeinsame Sicherheit, gleichen Zugang zu Ressourcen und Rechten. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, es wird Kräfte geben, die dagegen sind, aber die Mehrheit wird eine integrative Lösung unterstützen, vor allem, wenn sie von der Regierung kommt. Nur wenige Syrer:innen wollen glauben, dass alles verloren ist. Aber es muss jetzt gehandelt werden: eine echte nationale Konferenz mit Vertreter:innen aller Gemeinschaften. Alles, was in den letzten Monaten getan wurde, diente nur der Konzentration von Macht. Das funktioniert nicht. Angesichts einer Katastrophe wie der, die Syrien erlebt hat, ist es entscheidend, gut zu überlegen, bevor man handelt. Es braucht Weitblick.
Wie siehst du die Zukunft Syriens?
Ich neige dazu, apokalyptische Darstellungen abzulehnen. Nicht weil sie zu pessimistisch sind, sondern weil sie falsch klingen: Es handelt sich nicht um Interpretationen der Realität, sondern um Projektionen, versteckte Wünsche, unterdrückte Wut, zu Diagnosen recycelter Hass. Aber um ehrlich zu sein: Ich habe Angst. Angst, dass diese Tragödie schlimmer sein könnte als die anderen. Und wir wurden mit Tragödien überhäuft, vor allem in den letzten 14 Jahren. Ich habe Angst, dass all das noch vor statt hinter uns liegt. Wenn ich versuche, rational zu denken, habe ich das Gefühl, dass wir mit offenen Augen auf den Abgrund zusteuern.
Nach den Massakern an der drusischen Bevölkerung in Suwaida leben die Menschen in Angst, ihre Versorgung ist schlecht. Mit einer Spende für Syrien unterstützen Sie die medico-Nothilfe und stärken die Zivilgesellschaft in Syrien. Für Gerechtigkeit, für ein Ende der Gewalt, für die Würde der Opfer.
In einer längeren Fassung erschien das Interview im Juli 2025 bei L’Orient-Le Jour. Deutsche Übersetzung Harald Etzbach (Emanzipation). Dieser Beitrag erschien im medico rundschreiben 03/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!