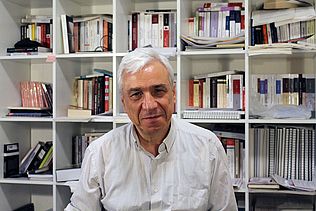Mitte Juli eskalierten Konflikte zwischen drusischen und beduinischen Bewohner:innen der südsyrischen Provinz Suweida in wochenlangen blutigen Massakern. Die Sicherheitskräfte der Regierung, die erst nach Tagen geschickt wurden, befriedeten die Situation nicht, sondern beteiligten sich an den Kämpfen. Ihre Loyalität gilt immer noch zuerst den Waffenbrüdern gegen das Assad-Regime. Die Idee eines gemeinsamen Syriens nach dem Sturz der Tyrannei im Dezember 2024 trägt bislang nicht.
Stand heute verloren bei den Massakern mehr als 2000 Menschen ihr Leben, zum größten Teil Mitglieder der drusischen Minderheit, systematische Exekutionen von Zivilist:innen wurden dokumentiert. Zehntausende sind aus ihren Dörfern vertrieben. Erst seit kurzem ist die Hauptstraße aus der Provinz nach Damaskus wieder frei nutzbar, Heckenschützen hatten zuvor dafür gesorgt, dass Fahrten nur in gesicherten Konvois möglich waren.
Die Versorgungslage in Suweida bleibt prekär, humanitäre Hilfe ist vom Syrischen Arabischen Roten Halbmond monopolisiert, der langjährige medico-Partner Kurdischer Rote Halbmond (KRC) versuchte wochenlang vergeblich, selbst Hilfsgüter dort hinzubringen. Die Initiative scheiterte immer wieder an bürokratischen Blockaden, hinter denen politische Konflikte zwischen der Zentralregierung und der Autonomieverwaltung im Nordosten des Landes stehen.
Immerhin kann mit Hilfe des KRCs und medicos Unterstützung aktuell ein Krankenhaus in Suweida dringend benötigte Krebsmedikamente beschaffen für Patient:innen, die auf regelmäßige Infusionen angewiesen sind und sich teure Medikamente nicht leisten können. Sie müssten sonst die Strecke nach Damaskus auf sich nehmen – was während der Blockade der Straßen wochenlang nicht möglich war.
Auch das von medico schon lange unterstützte Frauenzentrum ist in der Unterstützung von Vertriebenen aus Suweida aktiv. Ursprünglich aus Ost-Ghouta im Großraum Damaskus, hatten die Aktivist:innen während des Bürgerkriegs im nordwestlichen Idlib Zuflucht gefunden. Jetzt unterstützen sie drusische Frauen, die aus Suweida nach Dar‘aa im Südwesten Syriens an der Grenze zu Jordanien flüchten mussten, mit Hygiene-Kits und psychosozialer Hilfe. Viele von ihnen haben Tote in ihren Familien zu beklagen.
Das Center for Legal Studies and Research Syria, von syrischen Jurist:innen und Menschenrechtsaktivist:innen im Berliner Exil gegründet, ein weiterer medico Partner, hat ebenfalls einen Fuß in Suweida. Gegründet um Gefangenen und Angehörige in Syrien während der Assad Diktatur juristischen Beistand zu leisten, trainieren die Anwält:innen des Centers jetzt Jurist:innen online zu rechtsstaatlichen Konzepten wie „Rule of Law“ und „transitional Justice“, die für einen gemeinsamen Neuanfang in Syrien wichtige Voraussetzungen bieten. Auch die gerichtsfeste Dokumentation von Gewalt und Menschenrechtsverbrechen gehört zum Ausbildungsprogramm. Das macht die wirksame juristische Verfolgung solcher Verbrechen aus der Assad-Zeit und den aktuellen Massakern erst möglich. Im Juni, wenige Wochen vor der Eskalation nahmen an den online Workshops über 20 Rechtsanwält:innen aus Suweida teil.
Solche Arbeit schafft es meist nicht in die Medien, aber bildet einen enorm wichtigen Teil des prekären Demokratieprozesses in Syrien. Er ist dringend notwendig, um gegen die existierende Zersplitterung in Ethnien, Konfessionen und tribale Gruppen eine gemeinsame Perspektive in Syrien aufzubauen. Denn noch vor den Debatten um Zentralstaat oder Föderalismus, der aktuell von den politischen Akteuren in Damaskus, Latakia, Suweida und Qamishlo geführt wird, braucht es vor allem eine solche gemeinsame Perspektive. Daran arbeiten die Partner:innen von medico und viele andere zivilgesellschaftliche Akteur:innen, die sich in den letzten Monaten in Syrien neu gebildet haben oder aus ihren jeweiligen Enklaven wieder miteinander in Kontakt kommen.
Gerade angesichts dieser Prozesse sind die Gewaltausbrüche wie im Sommer in Suweida oder im März im alawitischen Latakia so bedrohlich. Sie entfalten eine Sprengkraft, die den von der Regierung beschworenen demokratischen Wiederaufbau untergräbt und stattdessen nur den misstrauischen Rückzug in die vermeintliche Sicherheit der eigenen (möglichst gut bewaffneten) Gruppe als Option sieht. Die Geschichte des Nachbarlandes Libanon, dem medico ebenfalls seit vielen Jahrzehnten verbunden ist, kann davon erzählen und es ist den syrischen Akteuren zu wünschen, dass sich nicht eine ähnliche Geschichte wiederholt.
Hoffnungsvoll stimmt der Optimismus, den die medico-Partner:innen und viele Syrer:innen im Land und in der Diaspora trotz allem noch haben. Diesen gilt es zu stärken – gegen die Instrumentalisierung der syrischen Akteure von großen und kleineren Playern, sei es Israel im Süden, die Türkei im Norden oder die näheren oder ferneren aus dem Libanon oder den Staaten am Golf. Auch davon kann der Libanon vielfach und schmerzvoll erzählen.
Sie können die Arbeit der medico-Partner:innen in Syrien mit einer Spende unterstützen.