medico: Cherien, Du bist selbst in den USA geboren, aber Dein Vater stammt aus Palästina. Wie viele persönliche Erfahrungen Deiner Familie sind in den Film miteingeflossen?
Cherien Dabis: Die Geschichte meines Vaters war für „Im Schatten des Orangenbaums“ eine große Inspiration. Ich habe viele Anekdoten und Ereignisse, mit denen ich aufgewachsen bin, im Film verarbeitet. Mein Vater hat den Großteil seines Lebens im Exil verbracht und musste – genau wie die Protagonist:innen im Film – schließlich erst Staatsbürger in einem fremden Land werden, um in seine Heimat zurückkommen zu können. Seine Sehnsucht nach diesem Ort war bei uns zu Hause immer präsent.
Eine Figur im Film sagt den Satz „Wir verlieren nie die Hoffnung“. Welche Rolle spielt Hoffnung für Dich in Deinem Schaffen als Filmemacherin?
Ich glaube, es ist die Hoffnung, die uns am Leben hält. Gerade unter entsetzlichen Umständen wie den aktuellen brauchen wir die Hoffnung, dass es besser wird und das Leiden weniger. Meine Figur sagt den Satz in den 1970er Jahren. Damals gab es deutlich mehr Anlass zur Hoffnung. Wenn ich heute sehe, wie schwierig die Situation in Palästina geworden ist, wie sehr die Gewalt zugenommen hat und wie polarisiert unsere Welt geworden ist, dann kommen uns solche Worte sicherlich schwerer über die Lippen. Und mit uns meine ich nicht nur Araber:innen und Palästinenser:innen, sondern jede:n von uns. Aufgeben möchte ich persönlich die Hoffnung trotzdem nicht. Auch in meinen Filmen ist sie von zentraler Bedeutung, und zwar nicht als eine Hoffnung in politische Führung, Regierungen oder Ideologien, sondern in die Menschheit.
Was hoffst Du, mit diesem Film beim Publikum in Ländern wie Deutschland und den USA zu erreichen?
Ich möchte den Menschen ein emotionales Erlebnis vermitteln, was es bedeutet, palästinensisch zu sein. Seit so langer Zeit werden Palästinenser:innen zu namenlosen, gesichtslosen Zahlen und Schlagzeilen degradiert. Ich glaube, dass wir wirklich daran gehindert wurden zu verstehen, wie sich die Ereignisse auf die Menschen in Palästina auswirken, wie Menschen täglich durch die Gewalt traumatisiert werden. Wir verwenden das Wort „Besatzung”, aber das ist ein sehr harmloser Begriff für etwas, das brutal gewalttätig ist. Mit diesem Film möchte ich den Menschen ein emotionales Erlebnis bieten, sie in die Lage der Palästinenser:innen versetzen und ihnen helfen, ihr Herz für all das zu öffnen, was Palästinenser;innen seit über 76 Jahren erdulden müssen.

Es gibt viele Hollywood-Filme, die sich mit Menschheitsverbrechen beschäftigen - darunter Schindlers Liste über den Holocaust, zahlreiche Filme über den Vietnamkrieg, Hotel Ruanda über den Völkermord dort usw. Warum, glaubst Du, sind die Nakba oder andere Tragödien, die die Palästinenser:innen seit 1948 erlitten haben, beispielsweise die Massaker in Kufr Qassem (1956 in Israel) oder Sabra und Shatila (1982 in Libanon), nicht auf dasselbe Interesse gestoßen, menschliche Tragödien zu – entschuldige den Ausdruck – Produkten mit fast popkulturellem Charakter zu verarbeiten?
Nun, weil Palästinenser:innen nicht existieren. So etwas wie Palästinenser:innen gibt es nicht. Das ist die vorherrschende Einstellung. Die vorherrschende Meinung ist, dass es eine Bedrohung für die Existenz anderer darstellt, wenn man über das palästinensische Narrativ von ethnischer Säuberung, Völkermord, Enteignung, Besatzung und Apartheid spricht oder dieses unterstützt. Wenn man diese Dinge anerkennt, bedroht man die Existenz anderer. Auf diese Weise haben Zionist:innen ihre eigene Darstellungsweise als Waffe eingesetzt, zumindest haben sie dieses Framing verbreitet. Es gibt Hindernisse und eine enorme Zensur, die uns davon abhalten, unsere Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte wurde aus den Geschichtsbüchern getilgt. Unsere Stimmen werden vollständig zensiert. Wann hast Du das letzte Mal eine:n palästinensische:n Expert:in auf CNN oder einem dieser Mainstream-Sender gesehen? Sie lassen jeden außer Palästinenser:innen über die palästinensische Erfahrung sprechen, weil wir vermeintlich die Existenz eines anderen bedrohen würden. Es ist an der Zeit, diese Mythen zu dekonstruieren.
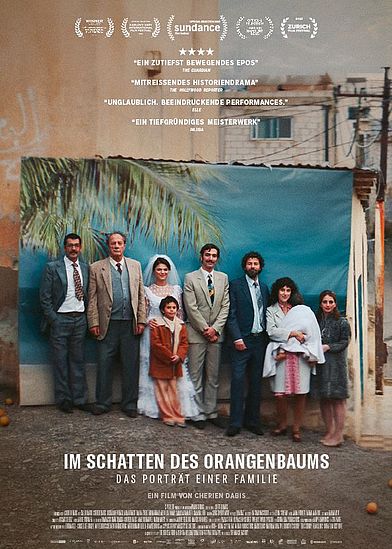
Würdest Du sagen, dass darin die besondere Bedeutung Deines Films für das hiesige Publikum besteht?
Ich denke, der Film dekonstruiert Mythen und stellt historische Tatsachen richtig, aber ich denke, noch wichtiger ist, dass er den Menschen eine emotionale Erfahrung davon vermittelt, was es bedeutet, Palästinenser:in zu sein. Das ist wirklich das Wichtigste, denn ich habe das Gefühl, dass den Menschen bisher verwehrt wurde, dies zu sehen oder zu fühlen, und ich denke, dass es einen großen Unterschied macht, wenn Menschen sich in die Lage eines Palästinensers oder einer Palästinenserin versetzen und sehen, was sie 1948 hatten und was ihnen genommen wurde. Wie kann man verstehen, was die Palästinenser:innen verloren haben, wenn man nie weiß, was sie hatten? Wenn man an den Mythos glaubt, dass Palästina ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land war, dann haben sie ja nichts verloren. In gewisser Weise ist es sehr wirkungsvoll, die Realität dessen zu zeigen, was passiert ist, was die Palästinenser:innen durch Gewalt verloren haben, was geplündert und gestohlen wurde, wie sie enteignet und zur Flucht gezwungen wurden, wie sie als Flüchtlinge in Lagern landeten. Es ist für mich erstaunlich, wie viele in der Welt diese Geschichte immer noch nicht kennen, dass es seit bald 80 Jahren wirklich erfolgreiche Bemühungen gibt, die Erzählung darüber zu untergraben. Das ist irgendwie verblüffend.
Das ist die Bedeutung des Films für, sagen wir, ein „westliches“ Publikum oder das Publikum in Ländern, die sich als westliche liberale Demokratien verstehen. Welche Bedeutung hat dieser Film für das Publikum in Palästina, Jordanien oder im Libanon?
Die Bedeutung liegt darin, dass wir uns selbst repräsentiert sehen, dass wir Momente unserer Geschichte sehen, die noch nie zuvor im Kino gezeigt wurden, dass wir feiern, was wir hatten, und dass wir eine Katharsis darin empfinden, dass die Welt die Wahrheit darüber sieht, was mit dem palästinensischen Volk geschehen ist. Weißt Du, es war für Menschen in Palästina, Jordanien und Libanon im Allgemeinen eine sehr emotionale Erfahrung, diesen Film zu sehen, die Wahrheit ihrer gelebten Erfahrung und das, was sie als wahr erkennen, auf einer Kinoleinwand zu sehen, und zwar auf eine Weise, wie es noch nie zuvor gezeigt wurde. Ich denke auch, dass so viele von uns sich mit dieser Geschichte verbinden können. Viele unserer Länder wurden vom Westen geteilt, erobert, kolonialisiert und verwüstet. Zu sehen, wie das Trauma von Generation zu Generation weitergegeben wird, trifft meiner Meinung nach viele Menschen sehr tief. Viele Leute haben mir auch gesagt, dass das Ende des Films für viele besonders überraschend ist und dass das moralische Dilemma, das sich am Ende des Films stellt, die Menschen in gewisser Weise dazu inspiriert, sich zu fragen: Was machen wir mit unserer Wut und unserem Trauma? Gibt es einen besseren Weg? Gibt es eine Möglichkeit, all unsere Wut zu kanalisieren, insbesondere als Menschen, die Opfer dieser Art von Gewalt geworden sind? Ich denke, das kann eine herausfordernde Frage sein, aber ich halte sie für wichtig.
Das Interview führte medico-Nahostreferent Riad Othman. In Kooperation mit X Verleih, der in Deutschland die Distribution des Films übernommen hat, finden sechs Vorstellungen mit anschließenden Publikumsgesprächen mit ihm statt. Siehe Veranstaltungen für mehr Informationen.




