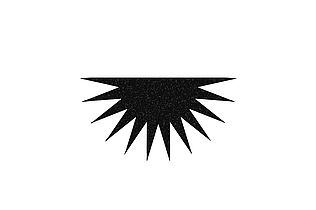„Ich hätte mir nie erträumt, dass ich je hier sitzen würde“ – Variationen dieses Satzes hört man an diesem Tag im Oktober 2025 ständig in einem Dorf am Rand der Stadt Saraqeb in der Region Idlib*. Fast ein Jahr ist seit dem Sturz des Assad-Regimes vergangen.
Aus Mangel an Perspektiven haben sich viele Jüngere aus dem Dorf den Sicherheitsstrukturen der Übergangsregierung in Damaskus angeschlossen. Viele von ihnen leben hier nicht mehr. Die umliegenden Dörfer sind seit der Rückeroberung durch die Armee des Assad-Regimes 2019 weitgehend entvölkert, die Menschen vertrieben. Erst in den letzten Monaten sind einige zurückgekehrt: aus Afrin, Jarablus oder dem Libanon. Ihre Häuser sind oft kaum mehr bewohnbar.
Der 50-jährige Nabeel stammt aus einem Dorf nahe Misyaf. Er ist einer von 30 Landwirt:innen, die sich hier für eine Woche mit medico-Unterstützung treffen, um die Souveränität über ihre Arbeit zurückzuerlangen. Vor einigen Wochen schloss er sich einem Kollektiv an, das entlang der Küste ehemalige Militärkasernen besetzt. Zunächst, um Geflüchtete unterzubringen. Dann, um die Kasernen in kollektive Farmen umzuwandeln. Die jüngste Besetzung versorgte sechs Familien mit einem Dach über dem Kopf – Menschen, die in den letzten 14 Jahren alles verloren haben.
Damit sie überleben können, setzt das Kollektiv auf Selbstversorgung: Pflanzenschutz, Dünger, Kompost. Was fehlt, sind Samen und Setzlinge. Saatgut ist in Syrien selten geworden. Mit Nabeel sind Landwirt:innen aus Raqqa, Damaskus, Deir Azzor, Suwaida, Tartous, Idlib und Qamishlo angereist.
Unweit der Farm bei Saraqeb, rund 30 Kilometer südlich von Aleppo, liegt das sogenannte ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) – eine 948-Hektar-Farm. Seit 1984 lagert dort eine der weltweit größten Sammlungen von Pflanzen aus Trockengebieten. Duplikate liegen im Libanon und in Marokko. Die Einrichtung soll sicherstellen, dass das landwirtschaftliche Erbe Syriens bewahrt bleibt.
Für Syrer:innen ist dieses Saatgut jedoch unerreichbar. Der Grund dafür liegt unter anderem in Syriens Geschichte begründet: Hafiz al-Assads Ernährungspolitik setzte auf den Bau massiver Staudämme und die Übernutzung von Grundwasser. Es war der syrische Beitrag zur sogenannten „Grünen Revolution“ – einer Agrar-Modernisierung, die auf Hochleistungssorten, synthetische Dünger und Mechanisierung setzte. Die ökologischen Folgen waren gravierend: degradierte Böden, austrocknende Grundwasserspeicher.
Gleichzeitig verdrängte der Fokus auf „strategische Kulturen“ lokale Sorten. ICARDA spielte dabei eine Schlüsselrolle. Ab den 1980er Jahren fungierte es als regionales Forschungszentrum. Getragen von USAID, der Rockefeller- und der Ford-Stiftung sowie der Weltbank sollte es Technologien der Grünen Revolution in Trockengebiete exportieren. ICARDA sammelte lokales Saatgut und überführte es in internationale Genbanken. Ein Prozess der Aneignung lokaler Biodiversität. Oder, anders gesagt, ein Akt kolonialen Ressourcen-Raubs. Die von ICARDA modernisierten Saatgut-Sorten blieben anfangs unter syrischer Kontrolle. Doch 2012, mitten im Krieg, verlagerte das Zentrum seine Arbeit in den Libanon.
Entfremdung im Ackerboden
Für Karl Marx liegt Entfremdung bekanntlich dort vor, wo Menschen den Zugang zu den Produkten ihrer Arbeit verlieren – wenn etwa ihr Wissen oder ihre Kreativität kontrolliert oder angeeignet werden. Auf Saatgut angewendet: Was als „Naturprodukt“ gehandelt wird, ist das historische Produkt von Jahrhunderten harter bäuerlicher Arbeit. Es entstand durch Selektion und Anpassung. Saatgut bleibt nur dann „lebendig“, wenn es weiter angebaut und klimatisch angepasst wird.
Die Vertreibung syrischer Landwirt:innen, der Verlust von Wissen, aber auch die Standardisierung von Saatgut sind Formen von Entfremdung. Bäuerliche Communities wurden zu Empfänger:innen „moderner“ Saatgutsorten, die sie weder entwickeln noch reproduzieren durften. Saatgut wanderte in Forschungszentren, Archive oder Genbanken ab – während diejenigen, die diese Vielfalt erst geschaffen hatten, den Zugang zu ihr verloren.
Vor diesem Hintergrund wirkt das Treffen nahe Saraqeb wie eine Rückaneignung: von Wissen und materieller Kontrolle über Grundlagen der Ernährung. Samenfestes Saatgut zu verwenden heißt, Sorten auszusäen, zu selektieren, es an Klima und Boden anzupassen. Es heißt, Trockenheit, Bodenerosion und Klimawandel in jeden Schritt einzubeziehen.
Die Menschen, die sich im Süden oder Nordosten Syriens oder auf der Flucht organisieren mussten, verfügen heute über einen reichen Erfahrungsschatz, den keine Institution in Damaskus je so hervorgebracht hätte. 14 Jahre Krieg, Vertreibung und Wiederaufbau haben ein Wissen entstehen lassen, das aus der Praxis geboren wurde.
Menschen außerhalb der Kontrolle des Regimes haben gelernt, Gemeinschaft neu zu denken. Aktivist:innen in Suwaida erprobten lokale Autonomiemodelle. In Nord- und Ostsyrien wuchsen selbstverwaltete Strukturen, die Räte und Gemeinwesen neu auslegten. In Raqqa und Deir Azzor bauten Menschen ihre Gemeinschaften aus dem Nichts wieder auf. Erfahrungen von Autonomie und Gewalt, Emanzipation und Überleben fließen hier zusammen. Das ist nach dem Sturz des Assad-Regimes nicht anders.
Zerbrechliche Begegnungen
Das kleine Dorf in Idlib zeigt das exemplarisch. Der Ort lag stets außerhalb staatlicher Kontrolle. Weil de facto niemand hier etwas genehmigt oder kontrolliert, wird Wiederaufbau zur täglichen Praxis von unten. In der lokalen Schule wurden etwa Tafeln einfach direkt auf Wände gemalt. Die alten Baath-Parolen stehen immer noch darüber – nicht weil man sie ehren würde, sondern weil sie schlicht keine Priorität mehr haben. Vorrang hat, dass Kinder lernen können.
Am letzten Tag des Treffens streichen Kinder hier Wände und pflanzen Bäume. Mahmoud bringt Setzlinge mit – ärgert sich aber, weil sie viel zu spät geliefert wurden. Genehmigungen? Behörden? Fehlanzeige. Menschen tun, was getan werden muss. Hier treffen Erfahrungen aus ganz Syrien zusammen – und formen einen Gegenentwurf zur staatlichen Vorstellung von Wiederaufbau.
An einem Morgen sind einige von ihnen zum Frühstück in die Stadt Saraqeb eingeladen. Auch Rasha aus Sahl al-Ghab und Lamis aus Suwaida sind mit dabei. Der Gastgeber war bis vor Kurzem noch Teil einer der bewaffneten Fraktionen. Als alle sich vorstellen, sagt er: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemals Alawiten sehen würde“. Rasha schweigt kurz, sagt dann: „Und dennoch hast du uns ein Frühstück aufgetischt, das den ganzen Boden bedeckt.“
Im Laufe des Gesprächs sprechen sie über die Massaker an der Küste und in Suwaida – er benennt sie offen. Für Rasha ist diese Form der Anerkennung wichtig. Sie hat 2011 Freund:innen verloren. Das schützte sie allerdings nicht davor, sich im März 2025 tagelang mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Gestrüpp verstecken zu müssen – aus Angst davor, überfallen zu werden. Lamis, die die Massaker in Suwaida miterlebt hat, hätte gern ehr erzählt: „Er hätte mehr zuhören können“, sagt sie später. Dass diese Begegnung überhaupt möglich ist in einem Land, das durch Gewalt und Vertreibung zerrissen wurde, bedeutet zwar noch keine Versöhnung. Aber doch eine Möglichkeit von Dialog, der hier über Jahre unmöglich schien.
Saatgut als Wiederaneignung
An einem der Tage des Treffens sind Vertreter:innen der Agrarpräsidien von Aleppo und aus Idlib eingeladen, darunter auch die Bauerngewerkschaft. Während der Eröffnungsrede gibt es deutliche Kritik an den privatwirtschaftlichen Firmen, die die Böden und Ökosysteme zerstören. Und auch an Produkten, die neue Abhängigkeiten schaffen und bäuerliches Wissen verdrängen. „Wir brauchen eine Rückkehr zu einem sauberen Leben“, sagt einer der Redner.
Im großen Zelt beginnt eine Diskussion über Saatgut. Muhannad, auf dessen Farm das Treffen stattfindet, ist sichtlich stolz: Rund 70 Menschen sitzen hier dicht gedrängt, hören einander zu, widersprechen sich, erzählen. Menschen aus Deir Azzor, Qamishlo, Mashta al-Hilu berichten von ihren Erfahrungen. Manche ziehen Parallelen zu anderen Kontexten. Dem Irak etwa: Dort führte die US-Verwaltung nach 2003 ein Patentrecht ein, das die Marktposition großer Firmen stärkte und Bäuer:innen entrechtete.
Im Dorf bei Saraqeb wird nun gefordert, dass ein syrisches Landwirtschaftsministerium die bäuerliche Vielfalt schützen müsse. „Das war eine klare Ansage an die Vertreter der Präsidien“, sagt Muhannad. Selbstbestimmung ist hier kein bloßes Ideal. Würde entsteht nicht von außen, sondern durch kollektive Selbstermächtigung. Souveränität und Autonomie sind hier keine theoretischen Begriffe. Es ist das tägliche Ringen darum, Kontrolle über Ernährung, Land und Leben zurückzugewinnen. Das ist die vielleicht radikalste Lektion aus Idlib: Revolution ist kein bloß historischer Moment. Sondern eine Infrastruktur – aufgebaut über Jahrzehnte.
Die Bewegung dahinter wächst nicht in den urbanen Zentren, sondern in einem kleinen Dorf, wo die Folgen des Kriegs bis heute am stärksten spürbar sind.
* Das Dorf, ebenso wie alle Personen, die im Text auftauchen, sind aus Sicherheitsgründen anonymisiert.
medico unterstützt seit vielen Jahren Initiativen, die in Syrien für eine demokratische Perspektive streiten – unter Assad und heute unter der HTS-Regierung. Dazu gehört auch die Wiederaneignung von Wissen, wie es die Bäuer:innen bei ihrem Treffen getan haben.