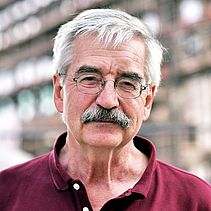In seinem lateinischen Ursprung steht das Wort Krise (lat. crisis) für ein Geschehen, das eine entscheidende Wendung bringt. Ob das auch für die gegenwärtige Corona-Krise gilt, bleibt abzuwarten. In welche Richtung sich die Dinge wenden könnten, bleibt bislang unklar. Die Chance eines emanzipatorischen Wandels besteht ebenso wie dessen Gegenteil, die Verfestigung bestehender Macht- und Herrschaftsstrukturen. Gerade in Krisenzeiten gilt es darauf zu achten, dass ein temporärer Ausnahmezustand später nicht zur Normalität wird.
Die Lage, die die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus heraufbeschworen hat, ist höchst ambivalent. Autoritäre Einschränkungen von Freiheitsrechten gehen einher mit bemerkenswerten Öffnungen. Zu Recht ist von einer „großen Unterbrechung“ die Rede. Mit der nun eingetretenen allgemeinen Entschleunigung des gesellschaftlichen Lebens ist auch die Möglichkeit verbunden, all das neu zu bestimmen, was für ein menschliches Zusammenleben wichtig ist. Braucht es wirklich Patente an essentiellen Arzneimitteln, die letztlich dafür sorgen, dass viele Menschen nicht versorgt werden können? Liegt nicht in der Sorge füreinander eine Form von Arbeit, die viel höher zu bewerten ist als das Streben nach privatem Profit? Und was spricht eigentlich dagegen, die eigene Lebensweise zu überdenken und dabei von einem die Umwelt schädigenden Konsum vieler unnützer Dinge zu entrümpeln?
Europa in Quarantäne – das provoziert Veränderungen, auch auf politischer Ebene. Der Markt, das wird gerade klar, regelt nichts. Selbst hartgesottene Neoliberale müssen heute einsehen, wie fatal sich die sozialen Einschnitte auf das Bildungs- und Gesundheitswesen ausgewirkt haben. Mit einem Kraftakt könnte es nun vielleicht gelingen, die Einrichtungen der Gesundheitsversorgung rasch zu rehabilitieren. Um die egoistischen Grundhaltungen, die mit dem politisch gewollten Kampf aller gegen alle geschürt wurden, wieder loszuwerden, aber wird mehr Zeit nötig sein. Mit einem bloßen Appell zur Solidarität wird es nicht gehen.
Selektive Sicherheit
Heikel wird es, wenn der Blick auf die Maßnahmen fällt, die nun weltweit zur Lösung der Krise ergriffen werden. Bedarf es tatsächlich der Verordnung eines disziplinierenden Notstandes bis hin zur lückenlosen Überwachung von Personen über ihre Smartphones? Oder braucht es nicht eher eine Aufklärungsoffensive, die partizipatives Handeln fördert und den solidarischen Beistand für alle organisiert, die von der Krise betroffen sind? Für die Erkrankten ebenso wie für die Millionen von Menschen, die nun in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind? Autoritäre Reaktionen wie Grenzschließungen, die sich auf eine öffentlichkeitswirksame Zurschaustellung von staatlicher Macht stützen, können in Krisenzeiten höchst attraktiv erscheinen. Doch in aller Regel ist es das – viel weniger auffällige – soziale Engagement von Sozialverbänden, Wohlfahrtsorganisationen und spontan entstehenden Initiativen, das für die Senkung von Infektionsraten sorgt. Das gilt auch in Zeiten von Social Distancing. Viele, die in den zurückliegenden Jahren den zu uns Geflohenen Beistand geleistet haben, tun es heute für ältere Menschen, die nicht mehr das Haus verlassen sollen. Die Einschränkung persönlicher Freiheiten, die in Krisenzeiten mitunter unausweichlich erscheint, darf niemals das solidarische Handeln beschränken.
Wer sich nicht der Logik des Ausnahmezustandes ergeben will, muss für die Idee einer offenen Gemeinschaft freier Menschen streiten. Dazu bedarf es nicht zuletzt eines kritischen Verständnisses von Recht und Sicherheit. Gerade in Krisenzeiten, wenn das Bemühen um Sicherheit Hochkonjunktur hat, ist das vonnöten. Wer wäre in unsicheren Zeiten nicht für Sicherheit? Die Sache aber ist komplizierter. Bei aller Verführung, die im politischen Streben nach Sicherheit liegt, bleibt unklar, was unter Sicherheit verstanden wird, wer Sicherheit definiert und für wen sie geschaffen werden soll.
Manche erinnern sich: Als in Deutschland 2006 die Vogelgrippe wütete, rückte auch die Bundeswehr dem Virus mit schwerem Gerät entgegen. Die skurrilen Bilder, die damals die Runde machten, erinnerten an längst überwunden geglaubte Formen einer kolonialen Seuchenmedizin, die mit einem „cordon sanitaire“ die Wohngebiete der Kolonialherren vor den Siedlungen der lokalen Bevölkerung zu schützen versuchte. Sicherheit ist zweischneidig. Wer von Sicherheit spricht, hat zuallererst die eigene Sicherheit im Blick – eine Sicherheit, die an bestimmte Territorien oder Privilegien gebunden ist. Für das Prinzip der Universalität, auf das sich die Menschenrechte gründen, gibt es in sicherheitspolitischen Überlegungen keinen Platz. Drängen Menschenrechte auf den Einschluss aller, kommt Sicherheit mit Abschottung aus. Mit Sondermaschine werden in diesen Tagen 100.000 Tourist*innen aus fernen Urlaubsgebieten zurückgeflogen, aber ein paar tausend schutzsuchenden Flüchtlingen die Aufnahme verweigert.
Die Selektivität des Sicherheitsdenkens, die sich hier so unmenschlich zeigt, steht nachhaltige Lösungen entgegen. Das heißt nicht, dass zur Bekämpfung von Seuchen nicht auch Quarantänemaßnahmen und andere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit vernünftig sein können. Aber es ist nur eine pragmatische Vernunft, die solche sicherheitspolitischen Antworten leitet. Mit ihnen lässt sich vielleicht das Management von Krisen optimieren, nicht aber die Frage klären, wie solchen Entwicklungen künftig präventiv begegnet werden kann. Es heißt, für analytische Betrachtungen gebe es in akuten Krisen keine Zeit. Ja, zur Bekämpfung von Krisen ist Handeln gefordert – aber es muss bedacht sein. Krisen können nicht mit den Prinzipien bekämpft werden, die sie begründet haben. Mit Krediten ist vielen, die nun finanzielle Ausfälle überbrücken müssen, nicht geholfen. So entstehen nur neue Abhängigkeiten und werden die Schrecken nur finanzialisiert. Vieles spricht dafür, das gesamte Wirtschaftsgefüge neu zu denken. Nur wer die Ursachen von Fehlentwicklungen kennt, kann auch deren Folgen unter Kontrolle bringen.
Rechte kann man nicht einfach ausschalten
Aber da ist noch ein weiteres Problem, das mit der Idee von Sicherheit verbunden ist. Das, was als Bedrohung empfunden wird, ist immer subjektiv gefärbt, emotional hoch aufgeladen und vage. Eben diese Unbestimmtheit macht Krisensituationen anfällig für Instrumentalisierungen und Verschwörungsphantasien. Politiker*innen, die ihre Gestaltungskompetenz den Vorgaben der ökonomischen Macht untergeordnet haben, können sich im „Zupacken“ bei der Abwehr deren negativer Folgen dennoch profilieren. Sie brauchen sozusagen die Krise, um sich gegenüber der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Das mag skurrile Formen annehmen, aber sie verfangen. Grenzen werden geschlossen, um einen „ausländischen Virus“ (so Donald Trump) abzuhalten, wo doch länderübergreifende koordinierte Aktionen notwendig wären. Mit martialischen Worten ruft der französische Präsident Emmanuel Macron seine Landsleute zum Krieg gegen das Virus – und hofft, darüber auch die großen sozialen Gegensätze vergessen zu machen, die Frankreich in den letzten Jahren in Aufruhr gehalten haben. Politische Legitimität aber stellt sich nicht allein über zupackendes Handeln her. Notwendig ist auch eine Idee von Zukunft. Allein zu hoffen, dass alles wieder wie früher wird, überzeugt wenig. Krisen verlangen danach, Fehler einzugestehen, Lehren zu ziehen und Konzepte vorzulegen, wie es anders werden soll.
Wenn sich Solidarität auf den Appell an eine vermeintliche Volksgemeinschaft reduziert, die nun geschlossen den einen Gegner zu bekämpfen habe, können gesellschaftliche Widersprüche nicht mehr demokratisch verhandelt werden und wird schließlich auch die Rechtsstaatlichkeit Zug um Zug ausgehöhlt. Wo die Sicherheit bedroht sei, müssten die Rechte der Menschen zurückstehen, verlangen es die Regierenden mitunter. Rechte sind aber nicht etwas, das man nach Belieben aus- und anschalten kann. Die Gefahr temporär außer Kraft gesetzter Rechte ist, dass sie dauerhaft verloren gehen. Gerade deshalb muss in Zeiten, die nach Sicherheit rufen, das Recht verteidigt werden. Allein das Beharren auf das Recht kann schließlich verhindern, dass der Ausnahmezustand zur Normalität wird.
Dieser Beitrag erschien zuerst am 26. März in der Freitag.