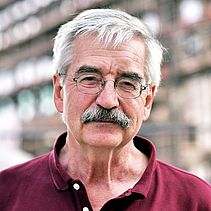Noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und verbunden mit großen Hoffnungen entstanden vor 75 Jahren die Vereinten Nationen. Nie wieder sollten die Verhältnisse in der Welt gewaltförmig eskalieren; endlich sollte das Recht auf ein würdiges Leben für alle Menschen verwirklicht werden. Der UN-Sicherheitsrat wurde eingerichtet, und neben ihm – fast noch bedeutender – der UN-Wirtschafts- und Sozialrat. Während der erste nur für den Notfall gedacht war, sollte der andere für das Fundament eines friedlichen Zusammenlebens sorgen: für soziale Gerechtigkeit.
Bekanntlich sind die Dinge anders gekommen. Zwar ist die Welt in den zurückliegenden Jahrzehnten näher zusammengerückt, doch zu einem sicheren Ort wurde sie nicht. Im Gegenteil. Nicht Gerechtigkeit und Frieden bestimmen heute das Geschehen in der Welt, sondern tiefe soziale Spaltungen. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, bürgerkriegsähnliche Zustände allerorten, ein dramatisch voranschreitender Klimawandel und nun auch noch eine globale Pandemie. Die Herausforderungen, mit denen sich die Welt gegenwärtig konfrontiert sieht, sind groß und das Bemühen um globale Lösungen ist dringender denn je. Dennoch suchen mehr und mehr Länder ihr Heil in Alleingängen und nationaler Abschottung. Ausgerechnet in dem Augenblick, in dem internationale Kooperation so nötig wäre, verflüchtigt sich die Idee des Multilateralismus.
Zu keiner Zeit waren die Vereinten Nationen die Weltgemeinschaft, für die sie von vielen gehalten wurde. In den Gremien der UN kommt nicht die Welt zusammen, sondern Vertreter*innen von Nationalstaaten, darunter mächtige und weniger mächtige, autokratische und auch ein paar, die demokratisch konstituiert sind. Sie alle mögen sich hin und wieder zur Universalität der Menschenrechte bekennen, drängen im politischen Alltag aber über die Durchsetzung höchst eigennütziger Interessen auf den Erhalt bestehender Privilegien. So lässt sich das globale Krisengeschehen nicht lösen. Dazu ist sowohl eine gerechte und nachhaltige Nutzung des vorhandenen Reichtums als auch die Umverteilung von Entscheidungsmacht notwendig. Insbesondere diejenigen, die derzeit die Hauptlast des prekären Zustandes der Welt zu tragen haben, die Menschen im globalen Süden, müssen zur entscheidenden Kraft werden. Der Trend aber zeigt in die andere Richtung.
Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist der Multilateralismus der Nachkriegszeit, so unvollendet er immer gewesen ist, durch eine neue Form globaler Politik abgelöst worden: den sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz. Die Idee, die dahinter steht, klingt vordergründig nicht schlecht. Alle, die von politischen Prozessen betroffen sind (und in diesem Sinne Anteil haben, also Stakeholder sind), sollen an der Entscheidungsfindung mitwirken. Neben Regierungen auch Vertreter*innen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, so die Theorie.
In der Praxis sind es allerdings höchst ungleiche Partner*innen, die da zusammenkommen. Mächtige Konzerne (nicht selten vertreten durch hochbezahlte Anwaltskanzleien), eine Politik (die vielleicht Sympathie für das Menschenrecht äußert, aber immer wieder, dem ökonomischen Diktat folgend, auf Sachzwänge verweist), einflussreiche Philanthrokapitalisten (ohne deren Zuwendungen offenbar nichts mehr geht) und schließlich auch ein paar zivilgesellschaftliche Akteur*innen (die dem Ganzen einen partizipativen Anstrich geben). Wer aber vertritt die Zivilgesellschaft? International aufgestellte NGOs, die längst eigene Interessen verfolgen, oder lokale Graswurzel-Initiativen und soziale Bewegungen? Mächtige Stiftungen oder demokratisch legitimierte Interessenvertretungen? So undurchsichtig das Zustandekommen von Multi-Stakeholder-Treffen ist, so selbstbewusst präsentieren sich deren Profiteure, die Lobbyisten der Wirtschaft. Hatten die früher nur mittelbar (in der Lobby) agieren können, sitzen sie nun ganz offen am Verhandlungstisch. Und so schreitet die Privatisierung der globalen Institutionen voran.
Im Juni 2019 besiegelten die Vereinten Nationen eine strategische Partnerschaft mit dem Davoser „Weltwirtschaftsforum“, um, wie es heißt, die 2015 beschlossene UN-Agenda der nachhaltigen Entwicklung, die SDGs voranzubringen. Privilegierter Partner der Weltorganisation wurde nicht das periodisch tagende „Weltsozialforum“, jenes bunte und offene Treffen von Vertreter*innen aus sozialen Bewegungen, Kirchen, Gewerkschaften, lokalen und transnational vernetzten Aktivist*innen, die auf eine andere, eine solidarische Welt drängen, sondern jener elitäre Zusammenschluss von Vertreter*innen aus Wirtschaft und Politik, der an der eingetretenen sozial-ökologischen Verwüstung der Welt nicht unbeteiligt war.
Es stimmt, dass zur Umsetzung der SGDs große Anstrengungen und viel Geld notwendig sind. Aber lässt sich die Welt wirklich retten über die Intensivierung einer Produktionsweise, die längst an ihre planetarischen Grenzen gestoßen ist? Das genau aber fordert das Kleingedruckte der UN-Agenda, die Ausführungsbestimmungen. Nicht durch eine gerechte Verteilung der bestehenden Ressourcen sollen die Ziele erreicht werden, sondern durch Wirtschaftswachstum, für das die Länder jeweils selbst zu sorgen haben. In der Frage, wie sie das vielleicht könnten, wird ihnen künftig nicht mehr eine multilateral verfasste „UN-Konferenz für Handel und Entwicklung“ (UNCTAD) zu Seite stehen, die wenigstens noch den Versuch gerechterer Austauschverhältnisse unternahm, sondern ein privater Club von führenden Konzernchefs und Wirtschaftslobbyisten, die gewohnt sind, „gewinnbringende Problemlösungen“ allein im Kontext von Kapitaleinsatz und unternehmerischem Management zu planen. Das Signal, das von der Partnerschaft der UN mit dem „Weltwirtschaftsforum“ ausgeht, ist fatal: nicht Demokratisierung ist angesagt, sondern die weitere Verschmelzung von Politik mit Ökonomie.
In Krisen die Kräfte zu bündeln, um beispielsweise rasch einen Impfstoff und Medikamente zu entwickeln, ist ohne Frage richtig. Falsch hingegen ist, wenn darüber in elitären Zirkeln befunden wird, wie das Anfang Mai auf Einladung der EU-Kommission in Brüssel geschehen ist. Da saßen weder Vertreter*innen aus den Ländern des Südens noch zivilgesellschaftliche Akteur*innen am Tisch. Dafür aber die Weltbank, das „Weltwirtschaftsforum“ und Unternehmensstiftungen, die schließlich dafür sorgten, dass die aus öffentlichen Etats für die Arzneimittelforschung bereitgestellten Milliarden allesamt von „Public-Private-Partnerships“ verwaltet werden sollen, nicht aber über die „Weltgesundheitsorganisation“, die von den Vereinten Nationen 1948 eigens für solche internationalen Steuerungsaufgaben geschaffen wurde.
Und so zeigt sich der prekäre Zustand der UN auch in ihren Sonderorganisationen. Auch die WHO leidet unter klammen Kassen, die sie in die Abhängigkeit von privaten Geldgeber*innen getrieben hat. Über den Einfluss der „Bill and Melinda Gates Foundation“ ist zuletzt viel geschrieben worden, kaum hingegen etwas über die im Mai formell gegründete private „WHO Foundation“. Deren Ziel ist es, die finanzielle Basis der WHO über Zuwendungen aus Wirtschaft und Philanthropie zu erweitern; für hochwirksame Programme, wie es heißt, über deren strategische Ausrichtung die Leitung der Stiftung mitentscheiden wird. Der Ausgleich, der so für die unzureichende öffentliche Finanzierung der WHO geschaffen werden soll, ist hochproblematisch: Statt über eine gerechte Finanz- und Steuerpolitik die fiskalischen Voraussetzungen für eine Stärkung der Unabhängigkeit der WHO zu schaffen, wird sie weiter dem Goodwill privater Geldgeber*innen ausgeliefert.
Heute liegen die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen am Boden. Ob sie jemals wieder die Rolle spielen können, die ihnen bei ihrer Gründung zugedacht wurde, ist fraglich. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die UN zu einer echten Repräsentanz der Weltbevölkerung zu transformieren. Um dem globalen Krisengeschehen wirkungsvoll begegnen zu können, bedarf es einer gänzlich anderen Politik, eines „new deals“ auf lokaler wie auch auf globaler Ebene.
Und vielleicht ist das der einzige verbleibende Ausweg: die Verständigung auf einen neuen Multilateralismus von unten. Was spricht dagegen, die Idee des UN-Wirtschafts- und Sozialrates vom Kopf auf die Füße zu stellen, in dem sich allerorten Menschen zusammenfinden, um bereits im Lokalen auf die Demokratisierung von wirtschaftlichen Zusammenhängen zu drängen? Was gegen die Bildung öffentlicher Gesundheitsforen, die das leisten, was in den bürokratisch-ökonomischen Apparaten nicht mehr gelingt, nämlich denen die Stimme geben, um deren Gesundheit es geht? Dass solche Hoffnungen nicht unbegründet sein müssen, zeigt der länderübergreifende Aufschrei gegen Waffengewalt, Klimazerstörung und Rassismus. Hier wächst ein neuer Multilateralismus, getragen nicht von Nationalstaaten, sondern einer Zug um Zug stärker werdenden transnationalen Öffentlichkeit.