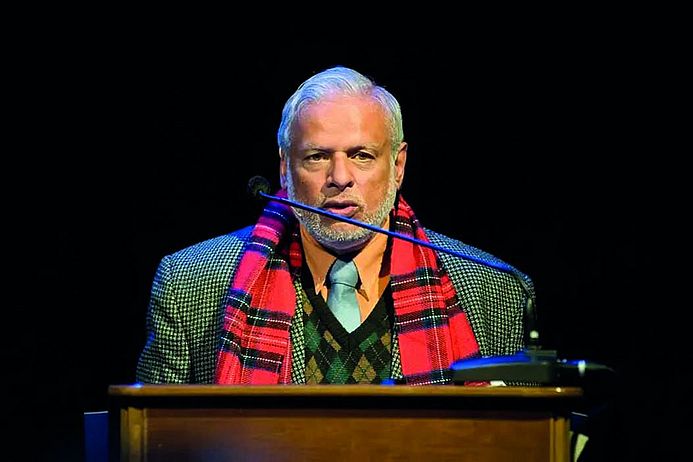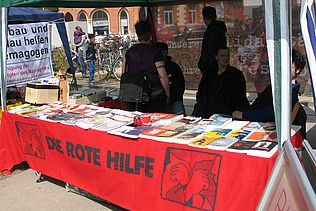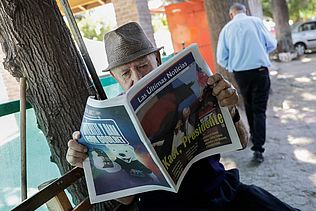Myanmar, Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan, Nepal, jetzt Indonesien und die Philippinen: In zahlreichen Staaten Süd- und Südostasiens sind seit 2021 breite Protestbewegungen entstanden, sogar mehrere Regierungen sind gestürzt. Die zum Symbol der Aufstände gewordene Piratenflagge aus der japanischen Anime-Serie „One Piece“ ist von Jugendprotesten in anderen Teilen der Welt aufgegriffen worden. Was ist da los?
Auf den ersten Blick scheinen es überall ähnliche Bewegungen zu sein. Dabei sollte man aber nicht übersehen, dass es in jedem Land andere Voraussetzungen und auch Auslöser für das Aufbegehren gibt. Sri Lanka war von einer extremen Wirtschaftskrise mit täglichen Stromausfällen, Benzinknappheit und einem drastischen Verfall der Lebensstandards gebeutelt, in Bangladesch erhoben sich junge Menschen, nachdem die Regierung mit einem Quotensystem für den öffentlichen Dienst ihre Aufstiegschancen beschränkte, in Nepal hat ein Verbot von Social-Media-Plattformen die Wut entfacht.
Dennoch gibt es ein gemeinsames Muster: Stets erhebt sich eine junge Generation angesichts trüber Zukunftsaussichten und fehlender politischer Freiheiten. Manche sprechen von den „Gen-Z-Aufständen“, andere in Anlehnung an den sogenannten Arabischen Frühling in den frühen 2010er-Jahren sogar von einem „Asiatischen Frühling“.
Es mag verlockend sein, die Entwicklungen unter solch prägnante Slogans zu fassen. Ich finde das wenig hilfreich. Um zu verstehen, was da los ist, sollte man einen Schritt zurückgehen. Einen langen Asiatischen Frühling haben wir in den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren erlebt, als ein Land nach dem anderen die kolonialen und imperialen Fesseln abwarf. Staaten wurden unabhängig, ein nationales Bürgertum kam an die Macht und postkoloniale Systeme entstanden. Diese waren alle mehr oder minder stark von parlamentarisch-demokratischen und liberalen Elementen geprägt. Es ging darum, eine moderne Nation zu werden, in der – zumindest vielerorts – auch Minderheiten Platz finden. Das war nicht nur ein politischer Frühling, er verband sich mit umfassenden kulturellen Aufbrüchen etwa in Kunst und Literatur. Dieser Frühling ist aber lange vorbei, die postkolonialen Systeme haben sich alle im Laufe der Zeit deformiert – der Glaube an die Kraft des Parlamentarismus ist geschwunden, die Staaten sind von Nepotismus und Korruption geprägt, der neoliberale, auf Extraktivismus ausgerichtete Kapitalismus richtete enorme Schäden an und führte zur Bereicherung Weniger. All das hat zu einer absoluten Legitimationskrise der Regierungen und des politischen Systems geführt: Das Misstrauen gegenüber den etablierten politischen Kräften ist gewaltig.
Die aktuellen Aufstände markieren also das Ende dieser postkolonialen politischen Systeme?
In jedem Fall haben viele einen äußerst kritischen Punkt erreicht – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. In Indien etwa ist trotz des autoritären und nationalistischen Kurses der Modi-Regierung der Glaube an das parlamentarische und föderale System mit geteilter Macht und einer bedeutenden Opposition noch weitgehend intakt. Unmut und spontane Mobilisierungen sind übrigens auch nicht ganz neu. In Südasien kam es in den vergangenen 20 Jahren immer wieder zu Protesten, ich erinnere nur an die massiven antiroyalistischen Aufstände in Nepal. Der interessante Punkt heute ist, dass es den Bewegungen tatsächlich gelingt, Regierungen zu stürzen – in Sri Lanka 2022, in Bangladesch 2024 und in Nepal im September 2025. Neu ist also nicht das Aufbegehren, neu sind das Ausmaß der Repräsentationskrise und die Schwäche der politischen Systeme. Mich erinnert das an die Umbrüche in Osteuropa. Auch dort sind realsozialistische Regime, die lange unantastbar schienen, binnen kürzester Zeit wie Dominosteine gefallen – und das weitgehend ohne Gewalt. Die Herrschenden hatten sich derart diskreditiert, dass sie selbst die Loyalität von Polizei und Militär verloren hatten.
Was im Vergleich zur Arabellion auffällig ist: Damals besetzten die Protestbewegungen öffentliche Plätze. In Kairo etwa wurde der Tahrir-Platz zum Fixpunkt der Mobilisierung. In Südasien werden hingegen Regierungsgebäude und Paläste gestürmt. Darin artikuliert sich ein Brass auf die Eliten, auf Verschwendung und Dekadenz. Könnte man von einer Rückkehr des Klassenkampfes sprechen?
Es gibt dieses Motiv, ja. Es handelt sich aber nicht um eine reine und klare Klassenbewegung, die treibenden Kräfte sind hauptsächlich Jugendliche der Mittelschicht. Alle Gesellschaften, über die wir hier reden, sind extrem jung. Es gibt also eine demografische Herausforderung, auf die die Regierungen Antworten finden müssten. Das fällt umso schwerer, weil der Neoliberalismus Arbeitsplätze vernichtet hat und die Künstliche Intelligenz diese Tendenz noch verschärft. In den Ländern des Südens sind unzählige junge Männer und Frauen aus den Dörfern in die Städte gekommen. Dort finden sie aber keine Perspektiven, zurückkehren können sie auch nicht, weil es auch auf dem Land keine Perspektive gibt. In Nepal haben die Protestierenden klar gesagt: „Wir wollen keine Sklavenarbeit im Ausland, wir wollen Arbeitsplätze hier, zu Hause, in unserem eigenen Land!“ Dass die Regierungen bislang Antworten schuldig geblieben sind, hat zu dem populistischen Momentum des Aufstandes der Jugend geführt, das wir aktuell erleben. Auch die Linke ist mit der Frage konfrontiert, wie sie damit umgehen soll. Und ich glaube, wir sollten vorsichtig mit Prognosen sein, wohin das Ganze führen wird. Was den sogenannten Arabischen Frühling mit den Bewegungen in Südasien heute verbindet, ist, dass sie über das Einverständnis, eine verknöcherte Ordnung stürzen zu wollen, hinaus keine konkrete Vorstellung haben, wohin es sich entwickeln soll. Der Mangel an Visionen ist eklatant. Es gibt keine Antwort auf die Frage „Was dann?“.
Dafür gibt es Gründe. Wir sprechen über Länder, in denen eine organisierte Linke entweder im Zuge von Militärjuntas und Bürgerkriegen eliminiert worden ist oder sich selbst diskreditiert hat. Die Frage lautet also auch: Geht es „nur“ um einen Mangel an Visionen – oder auch um Organisierung und „Führung“? Die Bewegungen sind zwar nicht in klassischer Weise organisiert – aber über Social Media bestens vernetzt.
Auf der einen Seite gibt es die beschriebenen strukturellen Krisen. Auf der anderen Seite vermitteln soziale Medien ein Gefühl von Macht, das aus der sofortigen Kommunikation entsteht, aber illusorisch ist – manchmal sogar halluzinatorisch. Als ob die Jugend die Machtstrukturen auf diese Weise neu gestalten könnte. Das ist eine seltsame Form der Sozialität. Deleuzes These, dass der Kapitalismus eine Maschine zur Erzeugung von Begehren ist, könnte nicht treffender sein.
Wie wird es Ihrer Einschätzung nach weitergehen?
Ich würde es so sagen: Im Moment spricht die Straße. Wohin das führt, ist ungewiss. Eine Ordnung zu Fall zu bringen, ohne eine Vision oder auch nur Ahnung davon zu haben, was sie ersetzen soll, ist gefährlich. Solche Umbrüche setzen Dynamiken frei, auf die progressive, aber wenig organisierte Kräfte nicht unbedingt vorbereitet sind. Wir haben in Nordafrika und im Nahen Osten erlebt, wohin das führen kann. Sei es in Libyen oder Ägypten: Vielerorts sind neue autoritäre Regime an die Macht gekommen, die im Gegensatz zu den Vorgängerregimen gar keine nationale Legitimation mehr haben und nicht mal mehr in der Geschichte eines postkolonialen Befreiungskampfes stehen. Diese Gefahren gibt es auch jetzt in Südasien. Um die dortige Entwicklung einzuordnen, muss man wissen, dass sich in den meisten Ländern in den vergangenen 20 Jahren im Zuge der Krise der politischen Systeme ein massiver Populismus breitgemacht hat, mal eher links, mal eher rechts. Gemeinsam ist ihm die Überzeugung, dass die bestehenden Institutionen für nichts mehr gut sind. Es mag darin auch anarchistische Momente geben. Man darf aber nicht übersehen, dass auch autoritäre und sogar faschistische Fraktionen mit am Werk sind. In Nepal gibt es zum Beispiel starke royalistische Tendenzen, die die Krone zurückholen wollen. In Bangladesch könnte das Militär früher oder später die Macht an sich reißen.
Gibt es nicht gute Gründe, zuversichtlicher zu sein? Immerhin ist in Sri Lanka der ehemalige Marxist Anura Kumara Dissanayake zum Präsidenten gewählt worden, in Bangladesch ist eine Übergangsregierung unter der Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus im Amt und in Nepal hat mit der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Sushila Karki, eine führende Antikorruptionsaktivistin die Regierungsgeschäfte übernommen.
Sri Lanka bildet eine Ausnahme. Dort haben die Wahl Dissanayakes und der überwältigende Erfolg des linken Bündnisses Nationale Volksmacht bei der Parlamentswahl das postkoloniale Parteiengefüge tatsächlich weggefegt. Sie repräsentieren eine politische Kraft, die bislang nicht am Machtblock beteiligt war und damit auch nicht Teil der Legitimitätskrise sind.
Keine sri-lankische Regierung der letzten Jahrzehnte verfügte über ein solch umfassendes Mandat über die Volksgruppen hinweg, die Probleme des Landes anzugehen.
Ja, aber selbst hier wird die Zukunft nicht allein im Land selbst entschieden. Vieles hängt davon ab, wie sich die Großmächte China und Indien verhalten werden. Innerhalb eines bestimmten Rahmens ist die Situation in Sri Lanka offen. Aber es gibt rote Linien. Wobei es zumindest China relativ egal ist, ob sie es mit einem demokratischen oder autoritären System zu tun haben. Dem Regime in Peking geht es darum, seine wirtschaftlichen Interessen in den jeweiligen Ländern verfolgen zu können. Vor allem bei Indien stellt sich die Frage, ob sie die Politik des „Hands off“ fortsetzen oder ob sie an der Seite bestimmter Fraktionen eingreifen werden. Indien lernt erst langsam den chinesischen Stil.
Das Interview führten Christian Sälzer und Karin Zennig.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico rundschreiben 04/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!