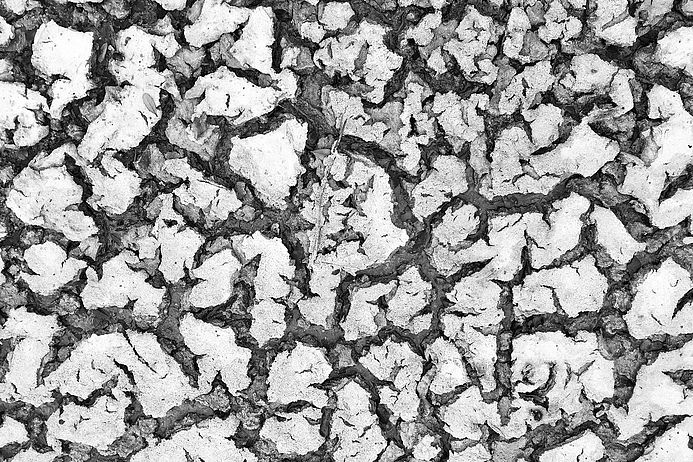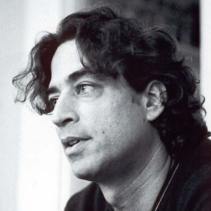Das Instrumentarium sogenannter Soft Power und andere Mechanismen, auf die sich die globale Hegemonie der USA in der Vergangenheit stützte, entsorgen Trump und seine Administration in zweiter Amtszeit in rasender Geschwindigkeit. Selbst der Anschein, die Demokratie zu verteidigen, für die Menschenrechte einzutreten und die Freiheit zu schützen, ist restlos aufgegeben worden. Dies bedeutet jedoch keinen Schwenk in Richtung Isolation, sondern steht vielmehr für die ersten Schritte hin zu einem post-hegemonialen Modell, das die globalen Machtbeziehungen in der kommenden Ära prägen könnte.
Diese Tendenz zeigt sich am deutlichsten, wenn zwei Ebenen in den Fokus rücken, auf denen die Welt neu kartiert wird: Zum einen erfahren der Weltmarkt und die Räume kapitalistischer Produktion und Zirkulation eine Transformation, zum anderen kommt es zu einer Neuordnung politischer Grenzen durch wiederkehrende Prozesse räumlicher Expansion und der Annexion von Territorien. In der Dynamik zwischen diesen beiden Prozessen einer Neuvermessung der Welt, bei denen politische Grenzen und die Gliederung des Weltmarkts mitunter deckungsgleich sind und ein anderes Mal auseinanderklaffen, zeigen sich die Hauptlinien des sich herausbildenden neuen globalen Arrangements. Dieser gesamte Prozess verläuft Hand in Hand mit der Entfaltung eines scheinbar nicht enden wollenden Kriegsregimes, das Handelskriege und militärische Konfrontationen gleichermaßen einschließt.
Überlappende Karten globaler Räume
Im Jahr 2014, als Russland die Krim eroberte, und auch noch im Jahr 2022, mit dem großangelegten Angriff auf die Ukraine, hatte es den Anschein, als griffe Putins autokratisches Regime mit seiner brachialen Taktik territorialer Expansion auf längst überholte Formen internationaler Machtspiele zurück und als sei dies eine Ausnahme, die sich eindämmen ließe. Heute jedoch, nach Israels territorialen Vorstößen, nicht nur im Gazastreifen und im Westjordanland, sondern auch im Libanon, in Syrien und vielleicht darüber hinaus, und ferner mit Trumps Drohungen, Grönland, Kanada, den Panamakanal und sogar den Gazastreifen zu annektieren, scheint das Paradigma territorialer Eroberung sich, wenn nicht normalisiert, so doch zumindest verfestigt zu haben. Der Historiker Anders Stephanson bringt Trumps Projekte (oder Phantasien) einer territorialen Expansion zu Recht mit der langen Tradition der US-amerikanischen Vorstellung eines Manifest Destiny in Verbindung, aber wir müssen dieses Phänomen zusätzlich in einem umfassenderen Rahmen betrachten. Der Umstand, dass die territoriale Gliederung der Weltkarte wieder einmal zur Disposition steht und Landnahme stattfindet, ist ein wesentlicher Aspekt der derzeit sich vollziehenden Neuordnung globaler Räume.
Gleichzeitig werden Zölle und Handelsschranken als Waffen eingesetzt, um die Grenzen und Bedingungen des Weltmarktes neu zu ordnen, trotz drohender Inflation, finanz- und gesamtwirtschaftlicher Turbulenzen und sogar einer Rezession in den USA. Auch auf diesem Feld macht Trump deutlich, dass die Praktiken der US-Hegemonie ausgedient haben.
Das kapitalistische Weltsystem hat sich in der Vergangenheit schon des Öfteren an das Auseinandertreten der sich verlagernden Grenzsysteme – von Landesgrenzen und kapitalistischen Grenzräumen – angepasst, aber in verschiedener Hinsicht bringen die Aktionen von Trump, Putin und Netanjahu sie näher zusammen und lassen sie überlappen. Zwar mag eine solche Tendenz, während sie bestimmten Fraktionen des Kapitals zugutekommt, den allgemeinen Umfang wirtschaftlicher Entwicklung und des Profits einschränken, doch entspricht sie in gewisser Hinsicht den klassischen Imperialismustheorien des frühen 20. Jahrhunderts. Es bleibt freilich noch zu sehen, ob die zeitgenössischen kapitalistischen Formationen, die Industrie- und Finanzkapital auf andere Weise miteinander verweben, mit dem Begriff Imperialismus angemessen zu beschreiben sind.
Die Atlantische Kluft
Die Restrukturierung des Weltmarkts und der politischen Grenzen im Gefolge des Ukraine-Kriegs reicht weit über die beiden direkt beteiligten Länder hinaus. Seit dem Beginn der russischen Invasion war klar, dass neben der Ukraine auch Europa als die große Verliererin dastehen würde. Das Vorgehen der USA hat trotz aller Wechselfälle stets darauf abgezielt, Europa unterzuordnen, vielleicht nicht im Sinne eines bewussten Plans, aber doch als objektive Tendenz. Oberflächlich betrachtet vollzog sich ein radikaler Umschwung: von der Unterstützung der Ukraine und dem Bekenntnis zur NATO durch die Regierung Biden hin zu Trumps Parteinahme für Putin, dem Entzug der militärischen Unterstützung für die Ukraine und der Geringschätzung der NATO. Während die erstgenannte Administration im Endeffekt Europa innerhalb des Atlantischen Bündnisses unterordnete, schwächt letztere fortgesetzt Europa als einheitlichen politischen und wirtschaftlichen Akteur, wobei die Beziehungen zwischen den USA und dem alten Kontinent keineswegs gekappt, sondern vielmehr auf der Grundlage neuer Hierarchien und Kräfteverhältnisse neu geordnet werden sollen.
Bei der europäischen Integration scheint zwar ein Sprung nach vorn möglich, allerdings unter Bedingungen politischer Fragilität und im Angesicht der ständigen Bedrohung durch eine zunehmend selbstbewusster auftretende faschistische Rechte. Ausformuliert wird die seit langem diskutierte „strategische Autonomie“ Europas, aber lediglich als massiver Aufrüstungsplan, der einen neuen militärisch-industriellen Komplex schafft, der sich unweigerlich auf US-amerikanische und israelische Waffenhersteller stützen wird.
Ausgerechnet diejenigen europäischen Politiker:innen, die bisher, vor allem in Deutschland, am striktesten auf Haushaltsdisziplin und einer Schuldenbremse bestanden haben, plädieren nun nachdrücklich dafür, solche Beschränkungen für Militärausgaben aufzugeben. War „Haushaltsverantwortung“ früher mit einer strengen Austeritätspolitik verknüpft, bedeutet das aktuelle Überschreiten von Budgetobergrenzen aktuell sogar noch härtere Sparmaßnahmen im Bereich der sozialen Sicherheit. Darüber hinaus fallen die europäischen Pläne mit einer globalen Tendenz zu einem „Kriegsregime“ zusammen, in dem die wirtschaftliche, technologische und wissenschaftliche Entwicklung von Sicherheits- und Militärlogiken angetrieben wird. Gleichzeitig dient die Erhöhung der nationalen Militärausgaben im Rahmen des europäischen Aufrüstungsplans „ReArm Europe“ als Ergänzung der langfristigen Strategie einer verstärkten Grenzsicherung und der Zurückweisung von Migrant:innen.
Trumps Bemühungen um die Wiederherstellung „normaler“ Beziehungen zu Russland, während die zur Ukraine abgeschnitten werden und Europa sich an den Rand gedrängt sieht, verweisen auf gleich mehrere historische Parallelen. Allerdings verdeutlicht beispielsweise das naheliegende Bild eines neuen Jalta die militärischen (und nuklearen) Risiken der aktuellen Situation, und betrachtet man jene Bemühungen als (umgekehrte) Wiederholung des von Nixon verfolgten Plans, China von der UdSSR zu trennen, wird deutlich, wie tiefgreifend und kaum auflösbar die aktuellen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und China sind.
Klarer zeigt sich die Situation indes, wenn wir das gegenwärtige Vorgehen der USA und anderer Staaten als Bestrebungen betrachten, die Räume des Weltmarktes neu zu ordnen, oft verbunden mit Konflikten um politische Grenzen. Aus dieser Perspektive können wir erkennen, dass wir uns an einem Wendepunkt in der Geschichte des kapitalistischen Weltsystems befinden.
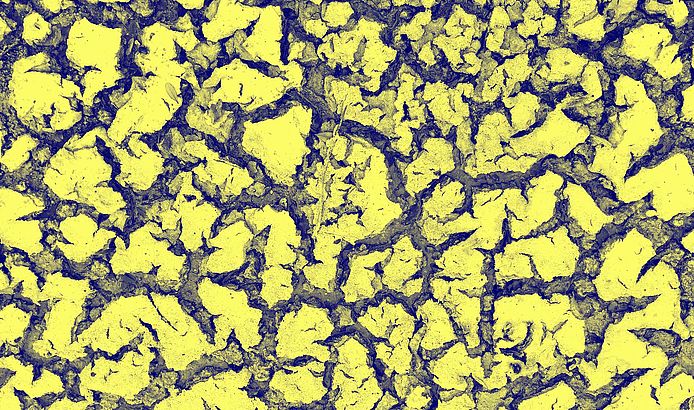
Die Landkarte des Nahen Ostens
Die Konflikte im Nahen Osten sind insgesamt in mehrfacher Hinsicht komplexer als die Situation in der Ukraine, und vieles ist noch im Fluss. Wirtschaftliche Interessen sind zwar wichtig, können aber auch hier die Situation nicht vollständig erklären. Der Gazastreifen ist zweifellos ein wichtiges Puzzleteil, und wenn Trumps davon phantasiert, sich das Land anzueignen, die Bevölkerung zu vertreiben und den Küstenstreifen umzugestalten, so ist dies bezeichnend für eine umfassendere Realität. Erdöl spielt natürlich bei allen politischen Zusammenstößen im Nahen Osten eine wichtige Rolle, aber nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie man es sich oft vorstellt. Denn auch wenn für den heimischen Verbrauch in den USA derzeit kein großer Bedarf an Öl aus der Golfregion besteht, gilt ein großes strategische Interesse dem Zugang der Konkurrenten, etwa China.
Seit langem ist der Nahe Osten ein logistischer Knotenpunkt mit einer Geschichte intensiver Konflikte, die bis weit vor die Suezkanal-Krise von 1956 zurückreichen, und Auseinandersetzungen um logistische Infrastrukturen rücken erneut in den Mittelpunkt. Das Abraham-Abkommen und der geplante Wirtschaftskorridor Indien-Nahost-Europa (IMEEC) beispielsweise, unterstreichen zum einen die Bedeutung der territorialen Kontrolle Palästinas, zum anderen beziehen sie auch Saudi-Arabien und andere Golfstaaten in das Projekt ein. Der Wettbewerb um logistische Infrastrukturen geht einher mit Konflikten um die Kontrolle von Ressourcen und deren Verteilung, die zwangsläufig eine regionale Dimension haben, wie beispielsweise beim Projekt der sogenannten Irak-Entwicklungsstraße oder dem „Mittleren Korridor“, der Transkaspischen Internationalen Transportroute (TITR), zur Verbindung der Türkei mit China.
Auf all diesen Prozessen lasten die Schatten und die Wirklichkeit des Krieges. Obgleich Stabilität und Sicherheit sowohl für die großen logistischen Infrastrukturprojekte als auch für die Ausbeutung von Rohstoffen und deren Handel davon abhängen, dass die Region wirksam und dauerhaft befriedet wird und tiefe, seit langem bestehende Gegensätze überwunden werden, ist der einzige Weg in Richtung Befriedung, den die USA und Israel anbieten, ein permanenter, auf Angst, Drohungen und Gewalt gründender Kriegszustand. Freilich sind Krieg und Handel immer schon eng miteinander verwoben, nicht nur in dieser Region. Die Tatsache, dass das Kriegsregime eine notwendige Bedingung für die wirtschaftliche Entwicklung im Nahen Osten ist, insbesondere angesichts der strategischen Bedeutung der Region für die globale Verteilung von Macht und Reichtum, verstehen wir daher als ein Symptom für die Grenzen, die der Neuordnung globaler Räume und damit des kapitalistischen Weltmarktes gegenwärtig gesetzt sind. Die dystopische Vision eines Gaza, das in die „Riviera des Nahen Ostens“ verwandelt werden soll, gemahnt nicht nur an die israelische genozidale Praxis der Zerstörung in diesem Küstenstreifen, sondern auch an die Plünderung und Enteignung, die mit den Projektionen globaler Macht der USA einhergehen. Unter diesen Bedingungen bleibt Palästina daher ein Name des Widerstands.
Die post-hegemoniale Tendenz
Auch wenn der Eindruck entstehen mag, die gegenwärtig tobenden Handelskriege markierten das Ende der Globalisierung, so liegt darin doch ein Missverständnis darüber vor, was Globalisierung eigentlich gewesen ist. Der Weltmarkt war weder ein Garten Eden des freien Handels, noch war er ein Raum reibungslos funktionierender Zirkulation, und wird dies auch nie sein. In der Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, erscheint, um an Marx’ Diktum aus den Grundrissen zu erinnern, „jede Grenze als zu überwindende Schranke“. Die gegenwärtige Situation der Entwicklung des kapitalistischen Weltmarktes stößt an eine Vielzahl von Grenzen, was zu einer Reihe von Brüchen und Störungen führt. Die Beschaffenheit der Hemmnisse und die Art und Weise, wie sie gegebenenfalls überwunden werden, können unterschiedliche Formen annehmen, und gerade unter diesem Gesichtspunkt wird die Beziehung zwischen territorialen Konfigurationen und solchen des Kapitals besonders wichtig. Der Weltmarkt ist immer schon und notwendigerweise politisch konstruiert und organisiert. Die Störungen des Weltmarktes in den vergangenen Jahrzehnten, sei es durch die Krise von 2008, die Pandemie oder die verschiedenen Kriege, sei es auf Schlachtfeldern oder durch Sanktionen und Zölle, unterstreichen wesentliche Merkmale des Weltmarktes selbst. Die grundlegende Aufgabe besteht darin, die wichtigsten Hemmnisse sowie die Ansätze, sie zu überwinden, zu identifizieren. Wir wollen keineswegs die Kriege in der Ukraine, in Palästina und anderswo auf die Dynamik des Weltmarkts reduzieren, aber dieser ist dennoch ein Terrain, auf dem die Kriege ausgetragen werden.
Heute sind wir mit der Möglichkeit eines globalen Systems konfrontiert, das nicht in dem Sinne, wie Giovanni Arrighi und viele andere das verstanden haben, durch eine Hegemonialmacht organisiert ist. Wenn die Vereinigten Staaten das Instrumentarium einer Hegemonialordnung aufgeben, bedeutet das nicht notwendigerweise, ein anderer Nationalstaat werde diese Rolle übernehmen. Es stellt sich indes die Frage, ob ein solches nicht-hegemoniales Projekt sich tatsächlich erfolgreich durchsetzen und von Dauer sein kann. Gegenwärtig scheint eine zentrifugale und konfliktgeladene Multipolarität eine angemessene Beschreibung des Zustands der Welt zu sein. Ein fortdauerndes oder sogar permanentes Kriegsregime zeichnet sich entsprechend als notwendiger Bestandteil sowohl der Organisation des Weltmarkts als auch der Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung ab. Die kapitalistische Welt verlangte immer schon Gewalt und Enteignung, jenseits des „stummen Zwangs“ der ökonomischen Kräfte, wie auch alle Regime des kapitalistischen „Freihandels“ immer schon auf die Waffen der dominanten Staaten und imperialen Mächte angewiesen waren. Ein Unterschied der gegenwärtigen Konjunktur besteht darin, dass es nicht erforderlich zu sein scheint, die Ausübung von Gewalt mit dem Vorbringen demokratischer Ideale oder zivilisatorischer Missionen zu legitimieren. Die post-hegemoniale Tendenz im globalen Maßstab deckt sich unter anderem in dieser Hinsicht eindeutig mit der Ausbreitung autoritärer und faschistischer Herrschaft auf der Ebene von Nationalstaaten.
Wie wir bereits andeuteten, scheinen viele dieser Entwicklungen die Merkmale des klassischen Imperialismus wieder aufleben zu lassen, darunter die Verbindung zwischen enormen kapitalistischen Monopolen oder Kartellen und der Macht dominanter Staaten sowie die Praxis der territorialen Expansion. Heute treten diese gewaltigen kapitalistischen Akteure auf eine Art und Weise unmittelbar politisch in Erscheinung, wie es früher nicht der Fall war. Abgesehen von der politischen Rolle, die der immensen Akkumulation von Reichtum immer schon zufiel, neigen aktuell große Plattformen tatsächlich dazu, grundlegende Infrastrukturen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu schaffen, dabei mit Staaten in Konkurrenz zu treten und so gewissermaßen als unmittelbar staatliche Akteure aufzutreten. Die Kontrollabläufe scheinen sich umgekehrt zu haben: Statt dass Staaten nationale oder transnationale Unternehmen einsetzen, neigen die Wirtschaftskonglomerate dazu, die Vorherrschaft über die Staaten auszuüben. Gleichzeitig müssen wir erneut darauf hinweisen, dass der Raum, den Trump sich für seine Projektion der ökonomischen Macht der USA vorstellt, ein begrenzter Raum ist, was eine geringere Dynamik der Wirtschaft impliziert. Daraus können sich für die kapitalistische Formation, die sich in den USA herauszubilden scheint, Grenzen und auch Widersprüche ergeben, darunter auch solche, welche die Position des Dollars als globale Leitwährung betreffen. An dieser Stelle wäre es zweifellos sinnvoll, diese entstehende Formation im Hinblick auf die Kapitalzusammensetzung, und damit auf die Beziehungen, Hierarchien und Reibungen zwischen den verschiedenen „Fraktionen“ zu analysieren.
China stellt mit seiner internationalisierten Wirtschaftsentwicklung sicherlich ein ganz eigenes Modell für globale Beziehungen dar. Jenseits einer von der Kommunistischen Partei Chinas propagierten Rhetorik des Freihandels und der Win-Win-Kooperation ist das chinesische Vorgehen in den letzten Jahren durch eine variable Geometrie der Projektion wirtschaftlicher Macht über staatliche Grenzen hinaus gekennzeichnet – vor allem durch das Projekt der sogenannten Neuen Seidenstraße, auch bekannt als „Belt and Road Initiative“, und das, was die Soziologin Ching Kwan Lee als das „über China hinausgehende China“ bezeichnet. Ungeachtet aller Unterschiede ist auch das chinesische Modell ein post-hegemoniales Projekt, das den Weltmarkt neu kartieren soll. Der Wettbewerb mit den USA und anderen regionalen Mächten ist keineswegs ausgeschlossen, aber dies als „neuen kalten Krieg“ zu betrachten, vereinfacht allzu sehr die variable Geometrie der wirtschaftlichen Expansion und reduziert sie auf eine Logik der Blockbildung, deren Bedingungen eindeutig nicht ausschließlich in oder von Peking bestimmt werden.
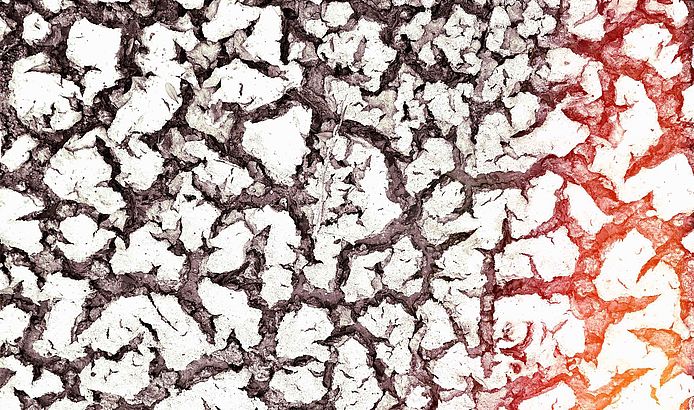
Ein kommender Zyklus von Kämpfen
Es ist vielleicht noch zu früh, als dass sichtbar würde, welche Arten von Aufbegehren und Kämpfen sich entwickeln werden. Sobald der Nebel der Orientierungslosigkeit sich lichtet und die Menschen sich in der neuen Situation zurechtfinden, werden wir in der Lage sein, die Kämpfe präziser zu analysieren. Dennoch lassen sich ein paar allgemeine Linien erkennen.
Ein guter Ausgangspunkt ist, anzuerkennen, dass „Widerstand“ als solcher heute eine unwirksame Strategie darstellt und alles Bemühen um ein „Zurück zur Normalität“ völlig illusorisch ist – ob in den USA oder anderswo. Vielmehr gilt es, Praktiken der Verweigerung mit einem neuen Projekt gesellschaftlicher Konstituierung zu verbinden. Ein Grund, warum wir die Analyse der Entwicklungen des Kapitalismus und der Dynamik des Weltmarktes, wie wir sie hier zu umreißen versucht haben, zusammen mit dem Organisieren des anti-kapitalistischen Kampfes für so wichtig halten, ist folgender: Natürlich müssen wir den Faschismus bekämpfen, das Kriegsregime und die post-hegemonialen Formen der globalen Herrschaft – aber wir müssen dies mit den gegenwärtigen Formen der kapitalistischen Herrschaft in Verbindung bringen und dabei immer bedenken, dass eines deren charakteristischer Merkmale, wie Marx und Engels immer wieder betonten, darin besteht, dass das Kapital, indem es seine eigene Entwicklung vorantreibt, notwendigerweise die Waffen liefert, um den Kampf dagegen aufzunehmen und die Grundlagen für die Konstituierung einer post-kapitalistischen Alternative zu schaffen.
Wir dürfen nicht erwarten, dass der chinesische Staat oder auch Staatengruppen, die in gewisser Weise für den „globalen Süden“ stehen, wie die BRICS oder die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, eine Führungsrolle im Kampf um Befreiung übernehmen. Einschneidende Verschiebungen stellen jede Aussicht auf eine nicht nur US-amerikanische, sondern überhaupt „westliche“ Hegemonie in Frage, und diese Verschiebungen können Risse erzeugen und Räume für Befreiungsprojekte öffnen. Doch der Widerstand gegen die aktuellen Formen globaler Herrschaft und eine wirksame Auflehnung dagegen müssen in sozialen Bewegungen und Kämpfen verankert sein, die in der Lage sind, sich ein Leben jenseits der Herrschaft des Kapitals vorzustellen.
Solche Bewegungen und Kämpfe sind unausweichlich in jeweils spezifischen, lokalisierten Kontexten verankert und konfrontieren das Kapital, den Autoritarismus, das Patriarchat und den Rassismus, die Enteignung, den Extraktivismus und die Umweltzerstörung in ihren jeweiligen Formen. Zugleich sind sich die Bewegungen zunehmend bewusst, wie wichtig es ist, die globale Dimension dieser Prozesse zu thematisieren und anzugreifen, und damit der Notwendigkeit einer Mobilisierung über Grenzen hinweg und gegen jede Form des Nationalismus. Ein neuer Internationalismus, in den lokalen, einzelstaatlichen und regionalen Realitäten verwurzelt und zugleich darüber hinausgehend, muss sich entwickeln. Nur durch einen solchen neuen Internationalismus kann letztlich eine Politik der Befreiung entstehen, die den heutigen Herausforderungen angemessen wäre. Der Riss im „Westen“ und der Niedergang hegemonialer Praktiken kann eine Gelegenheit bieten, um neue politische Verknüpfungen über Atlantik und Pazifik, Nord und Süd und andere Trennlinien hinweg zu schaffen und gemeinsam zu kämpfen.
Die Kräfte, um einen neuen Zyklus von Kämpfen in Gang zu setzen, die post-hegemoniale kapitalistische Ordnung in Frage zu stellen, das nicht enden wollende Kriegsregime zu überwinden und die autoritäre und faschistische Herrschaft zu bekämpfen, beginnen sich gerade erst zu finden. Auch wenn unsere Aussichten im Augenblick noch düster wirken, wird schon bald der Lichtstreif am Horizont sichtbar werden.
Aus dem Englischen von Thomas Atzert. Ursprünglich veröffentlicht am 3. April 2025 bei Verso.