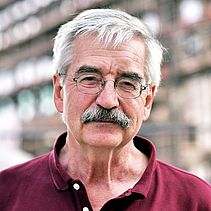„Wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte. Ohne gemeinsame internationale Anstrengungen werden die Leute einfach verhungern.“ Gerade von einer Reise in die Krisen-und Hungergebiete Ostafrikas und des Jemen zurückgekehrt, sprach der UN-Nothilfekoordinator Stephan O’Brien Anfang März 2017 vor dem UN-Sicherheitsrat. Ja, Hilfe sei dringend nötig, um die größte humanitäre Krise seit Gründung der Vereinten Nationen zu mildern. Vor allem aber müssten die UN und nicht zuletzt der UN-Sicherheitsrat rasch politisch handeln und die Ursachen des Hungers anpacken.
Noch ist unklar, ob sich die gegenwärtige Hungerkatastrophe tatsächlich zu einer Krise solchen Ausmaßes entwickelt. Aber bereits heute leiden mehr als 20 Millionen Menschen in Ostafrika und dem Jemen unter der Hungersnot und die Lage könnte sich schnell verschlimmern. Das Risiko für Krankheiten wächst. Traditionelle Lebensgrundlagen gehen verloren, und mit ihnen die Widerstandsfähigkeit der Leute und schließlich auch deren Hoffnung auf Zukunft. Viele werden sich auf den Weg machen, um anderswo nach Überlebensmöglichkeiten zu suchen. Die ohnehin schon fragile politische Lage in der Region wird weiter erschüttert werden.
Konflikte befeuern Not
Nicht zufällig sprach der UN-Nothilfekoordinator vor dem UN-Sicherheitsrat. Denn eines haben der Jemen, Somalia, der Südsudan und die anderen Krisenländer gemeinsam: Sie leiden unter zum Teil lange anhaltenden Konflikten. Diese Konflikte sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich im Zuge ungerechter weltwirtschaftlicher Austauschverhältnisse, wachsender sozialer Ungleichheit, fehlgeleiteter Militärinterventionen und notorischer Waffenexporte langsam entwickelt und die Ausbreitung des Hungers begünstigt.
„Greed and Grievance“, Gier und Frustration, seien die Triebfedern vieler lokaler Aufstände, die sich in den letzten Jahrzehnten zu Bürgerkriegen ausgeweitet haben, sagen Gewalt-forscher wie Paul Collier. Sie verweisen damit auf die ökonomische Dimension des Problems: den Kampf um Teilhabe an verwehrten Privilegien; den Groll, den Menschen verspüren, wenn sie feststellen, dass es für sie in den weltwirtschaftlichen Zusammenhängen keinen Platz zu geben scheint, dass sie „überflüssig“ sind. Mit humanitärer Hilfe ist solchen Umständen nicht beizukommen. Zumal das Elend, das es weltweit zu lindern gilt, längst überhandgenommen hat.
Schon heute sind 135 Millionen Menschen in über 35 Ländern auf humanitäre Hilfe angewiesen. Auf dramatische Weise übersteigt der Bedarf die zur Verfügung stehenden Mittel. Selbst die großen UN-Hilfswerke sind inzwischen überfordert. Die ungebremste Krisendynamik der letzten Jahrzehnte hat das internationale humanitäre System gesprengt. Gefordert ist politisches Handeln. Abhilfe kann nur schaffen, wer sich der Ursachen der Gewalt versichert – und so gilt es beispielsweise die Fehler zu erkennen, die bei der Gründung des Südsudan 2011 gemacht wurden.
Südsudan: Absehbares Scheitern
Schon damals war abzusehen, dass das Land an seinen inneren Widersprüchen zerbrechen wird: an ungelösten Konflikten um Land, Vieh und Bodenschätze, an Interessen von Anrainerstaaten, die unbeantwortet blieben, an rivalisierenden Rebellengruppen, die sich plötzlich in Regierungsverantwortung wiederfanden und ohne jede Vorbereitung die Verwaltung des neu gegründeten Staates übernehmen sollten. Zu erkennen sind auch die prekären Folgen einer falsch verstandenen internationalen Schutzverantwortung.
Das Drängen auf globale Verantwortung wird scheitern, wenn Entwicklung und Frieden zuvorderst unter sicherheitspolitischen Überlegungen und nicht im Kontext von sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Teilhabe gedacht wird. Letzteres erfordert präventives Handeln. Die Stunde der Sicherheitspolitiker schlägt dagegen erst dann, wenn akute Gefahren drohen, wenn die Krise bereits da ist.
Richtig verstandene Schutzverantwortung verlangt nicht die Entsendung von Militär, sondern etwa den Stopp deutscher Waffenlieferung an Saudi-Arabien, das seit Jahren im Schatten des Syrien-Konflikts im Jemen Krieg führt. Auch deutsche Waffen haben mit dazu beigetragen, dass heute im Jemen sieben Millionen Menschen nicht mehr wissen, wie sie sich morgen ernähren sollen.
Höchste Zeit ist es auch für eine Korrektur des weit nach Afrika hinein verlagerten europäischen Grenzkontrollregimes. Seine prekären Folgen zeigen sich gerade jetzt. Mit der Aufrüstung der innerafrikanischen Grenzen ist das verloren gegangen, was den Menschen z.B. in Zeiten von Dürre Schutz geboten hat: die Möglichkeit, vorübergehend in Nachbarländer auszuweichen.
Ambitionen und Nebelkerzen
Immerhin: Dass nicht Waffen und Militär Frieden schaffen, sondern Gerechtigkeit, diese schon bei den Propheten des Alten Testaments nachzulesende Erkenntnis, scheint sich inzwischen wieder herumzusprechen – selbst in Teilen der Bundesregierung. „Wir können nicht auf Dauer auf Kosten anderer Leben“, bekannte unlängst der Bundesentwicklungsminister, der im Januar die Grundzüge für einen „Marshall-Plan für Afrika“ vorlegte. 20 Millionen Arbeitsplätze will man nun in Afrika schaffen, die Infrastruktur und den Aufbau von Gesundheitssystemen fördern und – als Voraussetzung dafür – deutsche Unternehmen zu einer Steigerung privater Investitionen ermuntern.
Das Vorhaben ist ambitioniert. Doch mit Entwicklungshilfe alleine ist den Problemen nicht beizukommen. Solange es die weltwirtschaftlichen Verhältnisse zulassen, dass der machtvolle globale Norden den armen Süden systematisch übervorteilen kann, wird auch der „Marshall-Plan“ rhetorisches Strohfeuer bleiben.
Voraussetzung für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Afrikas wäre die Revision der vielen Freihandelsabkommen, die dem Kontinent – nicht zuletzt durch Europa – aufgezwungen wurden und werden. Solange den Ländern Afrikas untersagt bleibt, die eigene Wirtschaft z.B. durch Zölle oder Subventionen zu schützen, wird es keine nachhaltige Veränderung geben. Und so steht zu befürchten, dass die vielen neuen Jobs, die sich Entwicklungspolitiker an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Nahrungsmittelverarbeitung erhoffen, nicht über jene prekären Beschäftigungsverhältnisse hinausreichen werden, die heute in der internationalen Textilproduktion zu beklagen sind.
Auch mit Investitionen deutscher Unternehmen alleine ist es nicht getan. Voraussetzung ist ihre Sozialbindung und damit verbindliche internationale Regulierungen. Notwendig ist z.B. die Anerkennung und Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards, eine internationale Übereinkunft zur Bekämpfung von Steuervermeidung, die Gewährleistung von Freizügigkeit und nicht zuletzt die Verwirklichung der „UN-Richtlinien für eine verantwortliche Steuerung von Besitz an Land, Fischgründen und Wald“. Dazu freilich müssten sie von nicht bindenden Empfehlungen in ein verpflichtendes Regelwerk überführt werden. Ohne eine verbindliche internationale Übereinkunft zum Schutz des Gemeingutes Land wird sich der in Afrika notorisch gewordene Landraub fortsetzen und weitere Millionen von Menschen dem Hunger ausliefern. Genau das ist der Punkt, an dem sich die gegenwärtigen Afrika-Initiativen der Bundesregierung als Nebelkerzen entpuppen. Systematisch haben die zuständigen Ministerien für Wirtschaft und Justiz das Zustandekommen solcher Regelwerke, mit denen sich der global entfesselte Kapitalismus wieder einhegen ließe, verhindert.
Politische Unverantwortlichkeit
Das zentrale Problem der globalen Verhältnisse sei eine grassierende „politische Unverantwortlichkeit“, fasste es 2009 eine UN-Kommission unter Vorsitz des US-Ökonomen Joseph Stiglitz zusammen. Unter solchen Umständen von global tätigen Unternehmen zu erwarten, dass sie in Afrika etwas anderes als einen billigen Rohstofflieferanten bzw. den profitablen Absatzmarkt für eigene Produkte sehen, ist naiv. Warum sollten deutsche Unternehmen in den Erhalt einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft investieren, wenn sich das Geschäft mit technologieintensiven Großprojekten und industrieller Nahrungsmittelverarbeitung machen lässt?
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft Afrikas aber ist kein Anachronismus, der sich soeben mal dem Fortschritt opfern ließe. Sie bildet für weite Teile der afrikanischen Gesellschaften noch immer die Grundlage für Ernährungssicherheit. Wer an ihr rüttelt, liefert Menschen dem Hunger aus. Die gegenwärtige Krise ist auch eine Krise der Kohärenz. Viele der gut gedachten Konzepte scheitern nicht an ihren Zielen, sondern an der mangelnden Bereitschaft, sich mit den herrschenden ökonomischen und politischen Verhältnissen auseinanderzusetzen.
Und so bleibt es bei fatalen Strategien, etwa den derzeit so hoch im Kurs stehenden Resilienz-Konzepten, die nicht mehr um Krisenvermeidung bemüht sind, sondern darum, die Leute für kommende Katastrophen fit zu machen. Auch der eingangs zitierte UN-Nothilfekoordinator verlangt als Ausweg aus der Krise die Förderung der Resilienz und denkt dabei z.B. an private Risikoversicherungen und Katastrophenanleihen. Dass sich damit gute Geschäfte machen lassen, steht außer Frage. Für die Ärmsten der Armen, für Menschen, die mit weniger als einem Dollar am Tag auskommen müssen, werden sie aber unerreichbar bleiben.