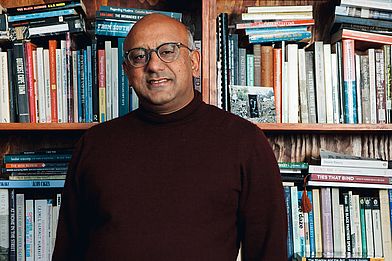Nach dem Ende des Systems Zuma ist in der südafrikanischen Gesellschaft ein Aufatmen spürbar, besonders bei denen, die den Kampf über Jahre geführt haben: zivilgesellschaftliche Organisationen und Medien, die unermüdlich Kritik äußerten und Hintergründe recherchierten; integre Personen des öffentlichen Systems, die sich der Korruption verweigerten und ihren verfassungsmäßigen Auftrag verteidigten; Oppositionsparteien, die ihre Rolle ernst nahmen. Möglich geworden ist der Aufbruch aber vor allem durch die radikale Veränderung des gesellschaftlichen Klimas, seit eine junge Generation an den Universitäten und Schulen im ganzen Land den Aufstand wagte – gegen den Fortbestand der kolonialen und rassistischen Logik von Bildungsinstitutionen, gegen die skandalöse ökonomische und soziale Ungleichheit, die sich in den Kategorien der Apartheid reproduziert, sowie gegen das Narrativ einer Versöhnung, die die Vergangenheit nicht aufarbeitet, sondern einen Mantel des Schweigens darüber gelegt hat. Im Zuge dieser Auseinandersetzung gelang es, fast unabsichtlich, die Forderung nach kostenloser Hochschulbildung für die Kinder der ärmeren Familien durchzusetzen. Die neue Regierung muss dies nun umsetzen – was Hypothek und Chance zugleich ist. Auch wenn keiner weiß, ob die Zukunft besser wird, und keiner dem neuen Präsidenten Cyril Ramaphosa wirklich vertraut: Einen Weg zurück gibt es nicht, auch nicht hinter die Erfahrung, dass jede staatliche Macht, sollte sie ihren Auftrag verraten, gestürzt werden kann.
Usche Merk: Nach jahrelangen mühsamen, aber auch hartnäckigen Kämpfen in verschiedenen Bereichen der südafrikanischen Gesellschaft ist es gelungen, Präsident Zuma von der Macht zu verdrängen und das – obwohl alle Zeichen dagegen sprachen – auf unblutige und letztlich demokratische Weise. Sein korruptes Klientelsystem an der Staatsspitze ist zumindest erschüttert, öffentlich entlarvt und diskreditiert. Wie beurteilst Du die aktuellen politischen Veränderungen in Südafrika?
Premesh Lalu: Ich bin vorsichtig optimistisch. Sehr ermutigend ist, dass sich die Haltung des Staates gegenüber seinen öffentlichen Einrichtungen und der Zivilgesellschaft verändert zu haben scheint. Zehn Jahre lang lebten wir mit Misstrauen, Verdächtigungen und politischer Intrige, die es sehr schwer machten, Institutionen aufzubauen. Öffentliche Einrichtungen hatten ihr Äußerstes versucht, um die Hinterlassenschaften der Apartheid zu beseitigen und die Anliegen aufrechtzuhalten, die nach 1994 formuliert wurden – zum Beispiel öffentliche Infrastrukturen verfügbar zu halten. Aber diese Sensibilität ist stetig erodiert, was die engagierten Schichten mehr und mehr hat erschöpfen lassen. Die Ereignisse der letzten Wochen haben ein Gefühl erzeugt, dass Staatsorgane sich neu an dem Mut und der Energie der Öffentlichkeit orientieren. Minister und Staatsträger scheinen wieder mehr zuzuhören und auf Kritik zu reagieren. Es gibt auf jeden Fall eine Stimmung, in der die Bürger sich selbstbewusster und optimistischer äußern. Die Aufgaben sind gleichwohl gewaltig. Wir haben einen Rückstau von zehn Jahren und eine extrem schwierige globale Situation. Zudem gibt es sehr viele Hindernisse und komplexe politische Kämpfe quer übers Land. Aber wenigstens lebt etwas von den Versprechungen aus den 1990er Jahren wieder auf. Es gibt wieder ein Verständnis, dass wir über technische Lösungen für die Probleme von Ungleichheit und Armut hinausdenken müssen. Wir sollten diese Energien so weit wie möglich nutzen.
Merk: In den zwei Wochen, in denen ich in Südafrika war und kurz in eine andere Realität eingetaucht bin, hatte ich das Gefühl, dass sich einige Symbole und Diskurse grundlegend verschoben haben. Unerfüllte Sehnsüchte und Ideen aus dem Anti-Apartheid-Kampf leben wieder auf.
Lalu: Seit 1994 sind die Regierungspartei ANC, aber auch die ganze staatliche Infrastruktur immer selbstgefälliger geworden, weil sie glaubten, das erreicht zu haben, was es braucht, um mit den Folgen der Apartheid umzugehen. Es gab eine demokratische Verfassung, die in der ganzen Welt bejubelt wurde, und eine Wahrheits- und Versöhnungskommission. Außerdem war man nicht mehr an die Strukturen aus dem kalten Krieg gebunden, in dessen Kontext sich die politischen Debatten über die Zukunft nach der Apartheid entwickelt hatten. Aber sie verstanden nicht, dass Südafrika in einem globalen Kontext gefragt war. Wegen seiner Erfahrung des rassistischen Systems der Apartheid wurde von Südafrika erwartet, dass es sich der Welt als substantielle intellektuelle Intervention anbietet. Ein Staat, der nicht zuhört oder nur das hört, was er hören will, übersieht diesen Schlüsselaspekt. Ich selbst komme aus der Jugendbewegung der 1980er Jahre. Jetzt aber hat eine Generation die Bühne betreten, die in der Demokratie geboren wurde und von einer tiefen Sehnsucht geprägt ist: Mit ihrem starken Gefühl von Idealismus hat diese Generation die Debatte über die Post-Apartheid-Freiheit als eine weltweite auf die Tagesordnung gesetzt. Antrieb der Diskussionen unter jungen Menschen in den Universitäten und Schulen ist ein Gefühl, auf eine viel bewusstere Weise zugehörig sein zu wollen. Sie wollen nicht nur Objekte staatlicher Dienste oder Empfänger von „Entwicklung“ sein, sondern Subjekte, die an der Definition der Bedeutung ihrer Freiheit teilhaben. Das ist eine unschätzbare Lektion für einen Staat, der aufgehört hatte zuzuhören. Und es geht nicht nur um Politik, es geht um Musik, um Film, um Bilder und darum, neue Bilder zu produzieren, es geht um das Verhältnis zu einer Welt neuer technologischer Ressourcen. Und es geht – auch das gehört dazu – um die Frustration, keinen Zugang zu diesen Ressourcen zu haben. Ich bin sehr begeistert davon, wie die junge Generation den sozialen Diskurs entscheidend verändert hat. Er kann dafür sorgen, dass die Post-Apartheid-Freiheit die Öffentlichkeit für das 21. Jahrhundert und ihre Bedeutung neu erfindet – und auf lange Sicht zur Entwicklung einer neuen Idee von Freiheit in der Welt beitragen.
Merk: Diese Veränderungen in Südafrika sind so merkwürdig und inspirierend, da sie die an so vielen Orten der Welt die Leute deprimiert und verzweifelt sind. In Südafrika herrscht Aufbruch, während es anderswo keine Hoffnung und kein utopisches Denken mehr zu geben scheint.
Lalu: Ich glaube nicht, dass es nur in Südafrika so ist, vielmehr beobachte ich es vielerorts auf dem Kontinent. Ich sehe es in Strukturen von jungen Leuten, die nicht mehr unbedingt das Mittelmeer überqueren, auswandern wollen, sondern darüber nachdenken, wie sie sich vor Ort neu definieren können und welche Ressourcen sich dafür mobilisieren lassen. Südafrika hat sich dabei von anderen Bewegungen in Afrika inspirieren lassen, von Dakar, Accra oder Nordafrika. Die Welt hat über Afrika stets in den Kategorien von Entwicklung oder Unterentwicklung nachgedacht. Dieses Paradigma aber ist für die junge Generation länderübergreifend nicht länger akzeptabel. Sie holen sich Mobilität zurück und ich glaube, dass das den politischen Diskurs auf dem Kontinent durchdringen wird. Es wird interessant werden, wie Afrika seinen Platz in der Welt wiedererlangen kann. Was können wir den Teilen der Welt anbieten, die im Griff rechtsradikaler Nationalismen und nihilistischer politischer Strukturen sind? Welche Möglichkeiten wohnen den aufkommenden ästhetischen und intellektuellen Traditionen Afrikas inne, die einen Ausgang aus den Drehbüchern der Gewalt in der Welt anbieten? Die lange und bittere Erfahrung der postkolonialen Kämpfe in Afrika haben zu sehr kreativen Lebensweisen geführt. Das neue Narrativ besteht darin, dass Afrika sich selbst als eine Möglichkeit zu erfassen beginnt, über die Welt nachzudenken. Ich gebe ein Beispiel: Der ganze afrikanische Kontinent musste sich immer mit der Frage der Figur des Migranten auseinandersetzen. Europa hat damit erst kürzlich begonnen und macht es nicht sehr gut. Afrika hingegen bietet eine Idee, wie man über die Figur des Migranten als politisches Subjekt nachdenken kann – eben nicht als Objekt von Hilfe oder als Abfluss von Ressourcen. Migration in einer grundlegend humaneren Weise zu verstehen und sich dazu in Beziehung zu setzen, ist eine Voraussetzung für eine bestimmte Art von Gastfreundschaft. Hier kann Europa viel von Afrika lernen.
Merk: Ich finde es sehr wichtig, was du sagst. Denn meines Erachtens gibt es in Europa nicht wirklich ein Bewusstsein, sich Afrika zuzuwenden, um die Antworten auf die Herausforderungen von heute zu finden: Post-Apartheid als globale Aufgabe zu verstehen und eine koloniale Logik zu durchbrechen, ohne nur Gesichter auszutauschen.
Lalu: Über eines sollten wir uns im Klaren sein: Afrika hat eine lange Geschichte der Beteiligung an den internen politischen Krisen in Europa. Afrikanische Unabhängigkeitsbewegungen waren von ihren Begegnungen mit den Kämpfen gegen den Faschismus in Europa grundlegend geprägt. In Südafrika gilt das doppelt, wenn wir bedenken, dass die Apartheid nach, durchaus aber im Umfeld des Faschismus entstanden ist. Daran zeigt sich, dass der Kampf gegen die Apartheid tatsächlich ein Kampf gegen ein Problem ist, das weit über Südafrika hinausweist. Während Europa sich in giftige Nationalismen zurückzog, bestanden die Kämpfe für Unabhängigkeit und Dekolonisierung nach dem zweiten Weltkrieg darauf, ein Konzept der Welt aufrechtzuerhalten. In gewisser Weise hatte Europa die Idee eines Weltkonzeptes aufgegeben. Ich denke an die Verzweiflung, die einen beim Anblick des Globusses überfällt, der in der Hand von Charly Chaplin’s „Der große Diktator“ explodiert. Chaplin zeigt damit meiner Meinung nach, dass das europäische Engagement für ein Weltkonzept im Moment des faschistischen Aufstiegs verschwindet. Die großen Denker der afrikanischen Befreiung – sei es Léopold Sédar Senghor oder Frantz Fanon – aber haben stets an einem Weltkonzept festgehalten, ob in revolutionärer oder humanistischer Form. Wenn du die intellektuellen Beiträge der antikolonialen Kämpfe betrachtest – die intensiven Debatten über die Bedeutung von Freiheit und wie sie nach dem Trauma des zweiten Weltkriegs aussehen könnte –, siehst du ein gemeinsames intellektuelles Bemühen, ein anderes Bild der Welt zu entwerfen. Afrikanische intellektuelle Traditionen haben mitten im Kampf um Unabhängigkeit ein Bewusstsein für die Welt aufrechterhalten. Das ist der Geist, der hoffentlich in Südafrika heute wieder auflebt.
Merk: Das hoffe ich auch. Europa gehen die Ideen aus, es sollte sich mit Diskursen verbinden, die anderswo schon stattfinden.
Lalu: Edouard Glissant spricht von der Poetik der Beziehungen. Wir sollten uns fragen, wie die Welt aussehen könnte, würden Ideen die Hemisphären durchqueren, und welch unterschiedliche Resonanzen sie auf dieser Reise auszulösen vermögen. Die Welt des Wissens ist das, was wir teilen, wenn auch nicht gemeinsam. Es ist wichtig, dass wir dem Fluss der Ideen offen gegenüberstehen. Und wir müssen herausfinden, wie Afrika nicht auf einen Diskurs von Entwicklung und Unterentwicklung reduziert werden kann. Dieses Paradigma sperrt das Potential der psychischen und kollektiven Selbstwerdung ein. Vielleicht zeigt uns die Begegnung mit den neuen technologischen Ressourcen, wie viel mehr auf dem afrikanischen Kontinent passiert.
Merk: Was wären Deine Ideen und Empfehlungen für eine Organisation wie medico, die ihren 50. Geburtstag zum Anlass nehmen will, zurückzuschauen, zu reflektieren und sich neu zu erfinden?
Lalu: Mir fallen drei wichtige Bereiche ein. Der erste: Wie stellen wir wieder ein Bild der Welt her? Wir brauchen nicht nur eines sondern viele, die uns ermöglichen, den spezifischen Moment beschreiben zu können. Es bewegt sich vieles in der Welt und wir müssen herausfinden, welche Bilder diese Bewegungen ermöglichen und unterstützen und dabei die Gewalt verringern. Das zweite ist, über die Poetik von Beziehungen nachzudenken. Wie denken wir zum Beispiel über neue Beziehungen zwischen Mensch und Technik nach? Sie betrifft jeden Aspekt des Lebens, hat Einfluss auf das Gedächtnis, unsere psychische und emotionale Selbstwerdung, unsere Sinne. Wir brauchen eine andere Deutung von Technologie als die, die die Frankfurter Schule in den 1930er Jahren entwickelt hat. Das Dritte ist, Beziehungen quer über Hemisphären zu schaffen. Begriffe wie „globaler Norden“ und „globaler Süden“, die so verbreitet sind unter Geber- und Entwicklungsorganisationen, sind einengend und auf vertraute Weise einseitig. Besser wäre es, quer zu den Hemisphären zu denken, um das gemeinsame Engagement einer Weltzugewandtheit aufzuzeigen. Ich würde gerne von Bewegung und der Poesie der Beziehungen als einem Projekt denken, das Hemisphären überkreuzt: statt Nord-Süd auch Ost-West, Ost-Süd oder Süd-Süd. Hemisphären sind wie Membranen, durch die wir hindurchgehen.
Merk: Brauchen wir dafür nicht auch eine neue Sprache?
Lalu: Wenn Du jungen Leuten zuhörst und siehst, wie sie reisen, lernst du schnell die Grenzen einer Sprache kennen, die sich im geopolitischen Umfeld des kalten Krieges ent wickelt hat. Ich habe ein digitales Kulturprojekt in Mexiko-Stadt mit großem Interesse verfolgt. Es ist absolut faszinierend, wie diese jungen Leute in und mit der Welt verbunden sind. Das ist eine Art und Weise zu lernen, die zu Zeiten der Berliner Mauer unvorstellbar war. Wir müssen das Aufregende nutzen und die Debatte verschieben: Statt von der Nutzung der Technik zu sprechen, sollten wir das Wissen über die Technik erweitern. Wir müssen auch aus dem Würgegriff des Entwicklungsparadigmas ausbrechen, wenn wir über einen Ort wie Südafrika sprechen. Das bedeutet nicht, die Probleme zu negieren. Ich schlage aber vor, dass wir uns den Energien zuwenden, die neue Imaginationen und intellektuelle Diskurse haben entstehen lassen. Das sind die Quellen eines lebensbestätigenden Narrativs. Im Moment engagiere ich mich dafür, wie wir dem Konzept der Post-Apartheid-Freiheit diese übergreifende Vision verleihen können. Hoffentlich ermöglicht uns die Veränderung im politischen Glücksspiel von Südafrika, dieses Ziel zu erreichen. Es wäre ein wunderbarer Tag, würde man Afrika als Ressource dafür sehen, wie man das Leben lebenswert macht.
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 1/2018. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. <link verbinden abonnieren>Jetzt abonnieren!