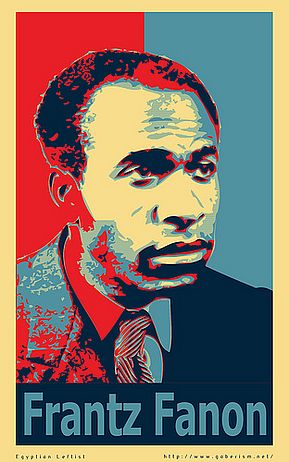Eine gute Idee droht zu scheitern! Eine, die in Plenarreden und auf Kirchentagen immer wieder beschworen wurde und doch weitgehend folgenlos geblieben ist: im Globalen wie im eigenen Land. Ganz offenkundig verliert die Idee des Dialoges, mit der sich noch vor Kurzem so große Hoffnungen verbunden haben, wieder an Überzeugungskraft.
Wer sich von der Vielzahl der Gespräche, Gipfel und Zusammenkünfte, die heute zwischen den Kulturen und im Nord-Süd-Verhältnis geführt werden, den Blick nicht verstellen lässt, erkennt, dass es noch immer weniger um Verständigung geht als um die Behauptung des jeweils Eigenen. Kaum einmal stehen reale Machtverhältnisse und die damit einhergehenden Privilegien zur Disposition. Nicht der Ausgleich zwischen divergierenden Interessen steht auf der Tagesordnung, sondern deren Durchsetzung. Mit einer immer offener zutage tretenden Identitätspolitik soll das eigene Lager zusammengeschweißt und die Missachtung der Anderen gerechtfertigt werden. Was Wunder, dass die Segregation der (Welt)-Gesellschaft wieder zunimmt - allen Bemühungen um Dialog zum Trotz.
Es war der 1961 verstorbene Psychiater, Revolutionär und Kulturtheoretiker Frantz Fanon, der deutlich machte, wie schwer, ja unmöglich die Verständigung zwischen Menschen fällt, wenn sie auf der jeweils anderen Seite des Abgrunds stehen. Wie, so fragte Fanon mit Blick auf den damaligen europäischen Kolonialismus, sollte denn auch Verständigung möglich sein, wenn die einen die anderen gar nicht als Menschen betrachteten?
Ausgangspunkt für Fanons Kritik waren seine Erfahrungen als Arzt in der französischen Kolonialverwaltung in Algerien. Fanon wusste, wovon er sprach. Er studierte das Unverständnis, mit dem seine Kollegen auf die nordafrikanischen Patienten reagierten. Da Letztere kein eindeutiges organisches Krankheitsbild zu schildern vermochten, galten sie den Ärzten als eingebildete Kranke, die aus Faulheit in Behandlung kamen. Die Ärzte waren nicht imstande, das diffuse Leiden der Patienten als eine völlig normale Antwort auf eine zutiefst inhumane Kolonialgesellschaft zu entschlüsseln. Sie diagnostizierten ein "nordafrikanisches Syndrom", das ihnen als Bestätigung ihrer rassistischen Vorurteile diente. Letztlich misslang die Verständigung, weil man über keine gemeinsame Sprache verfügte, die die kolonialen Machtverhältnisse zu erfassen vermochte.
Seit der Phase der Entkolonisierung sind viele Jahrzehnte vergangen - und mit ihnen auch die Zeiten einer nachkolonialen Verständigung. So fragil das Bemühen um Ausgleich auch immer gewesen war, mit der globalen Entfesselung des Kapitalismus wurde es wieder zunichtegemacht. Dabei stehen die neuen Trennungen den kolonialen in nichts nach. Der Spaltung der Welt in einen wirtschaftlich, politisch und kulturell dominanten globalen Norden auf der einen Seite und die Zonen des Elends und der Demütigung im globalen Süden auf der anderen hat erneut jede Verständigung schwierig, ja unmöglich gemacht. Die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, wie sie zuletzt von Jürgen Habermas nach den Terroranschlägen vom 11.9.2001 angemahnt wurde, ist ausgeblieben, vielerorts durch eine fatale Sicherheitspolitik bewusst hintertrieben worden.
Zu den empörenden Entwicklungen im Nahen Osten gehört fraglos auch die planvolle Verhinderung der Kommunikation zwischen der palästinensischen und der israelischen Bevölkerung. Seit es die Mauer gibt, interessiert es auf israelischer Seite kaum noch, wie es den Leuten auf der anderen Seite geht. Vielen gelten die Palästinenser nur noch als Sicherheitsrisiko. Doch auch den Palästinensern fehlt nun der Kontakt zur anderen Seite. Immer weniger können sie begreifen, dass es auch Israelis gibt, die mit der Politik ihrer Regierung nicht einverstanden sind.
Angesichts solchen Auseinanderdriftens von habituellen Wahrnehmungen und Denkweisen, angesichts der immer unversöhnlicher sich gegenüberstehenden jeweiligen kulturellen und politischen Erzählstränge ist das weitgehende Scheitern der UN-Nachfolge-Konferenz gegen den Rassismus, die kürzlich in Genf stattgefunden hat, nicht eigentlich verwunderlich. Gerade Deutschland hat durch sein Fernbleiben deutlich gemacht, wie wenig es bereit ist, andere Erfahrungswelten und Narrative zur Kenntnis zu nehmen und gemeinsam mit anderen um eine neue Sprache zu ringen.
So oft von Verständigung heute geredet wird, so wenig steht sie wirklich auf der Agenda. Das zeigt auch das skandalöse Geschehen rund um den diesjährigen Hessischen Kulturpreis. Mit ihrer Entscheidung, Navid Kermani den bereits zugedachten Preis wieder abzuerkennen, lässt die Hessische Landesregierung keinen Zweifel daran, dass sie die Begegnung mit dem Fremden noch immer zuallererst als dessen Unterwerfung versteht. Offenbar dürfen Muslime erst dann gemeinsam mit christlichen Würdenträgern ins Rampenlicht, wenn sie zuvor der Kritik abgeschworen haben, die der Islam aus theologischer Sicht nun mal am Kreuz führt.
Zugleich verdeutlicht das Geschehen rund um den Hessischen Kulturpreis auch, wie subtil sich Identitätspolitik ereignet. Religionskritik und so auch die Kritik am Kreuze ist nie nur eine Sache von außen gewesen, sondern kam in den vergangenen Jahrhunderten ja gerade aus dem eigenen Lager. Ohne Säkularisierung keine Aufklärung, ohne Religionskritik keine Geschichtsphilosophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellte, keine Psychoanalyse und auch keine moderne Literatur. Das Verblassen der Religion im Zuge von Aufklärung haben Amtskirche und weltliche Macht immer mit Argwohn betrachtet. Da trifft es sich, wenn nun der Widerspruch im eigenen Lager nach außen entsorgt werden kann, indem man den Muslim zum Träger der Kritik macht. Identitätspolitik par excellence.
Die Folgen solcher Polarisierungen sind weitreichend. Würde man heute die hiesige Öffentlichkeit zu ihrer Meinung über die somalischen Piraten, die Jugendbanden El Salvadors oder die radikalen Paschtunen in Afghanistan befragen, es kämen vermutlich allerlei Zuschreibungen zum Vorschein, aber wenig Verständnis: Von "Chaoten, Terroristen und Kriminellen" wäre die Rede, und kaum jemand könnte erkennen, wie es die eigenen Lebensumstände sind, die das Verhalten der vermeintlichen "Chaoten, Terroristen und Kriminellen" auf so unheilvolle Weise mit verursachen.
Wie zu Zeiten Fanons verdichtet sich heute wieder jenes manichäische Weltbild, das die Welt schon immer in Licht und Finsternis gespalten sah: Nur scheint es heute weniger die Behauptung eines Gegensatzes von Humanismus und Barbarei zu sein, der die Welt spaltet, als vielmehr der zwischen Privilegierten und Ausgeschlossen. Wie selbstverständlich genießen die einen das Gros des weltweiten Reichtums, den sie den anderen - aller Menschenrechtsrhetorik zum Trotz - vorenthalten. Die Sprache, die solche Gegensätze rechtfertigt, ist die Sprache des Neoliberalismus, die zur Begründung des sozialen Ausschlusses nicht unbedingt mehr auf rassistische Zuschreibungen zurückgreifen muss. Heute reicht der Verweis auf ein vermeintliches Versagen der Anderen. Sie seien an ihrem Ausschluss selbst Schuld, weil sie ihre Chance einfach nicht genutzt hätten.
"Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht", lautet die zentrale Botschaft des Neoliberalismus, die ebenso wie Maggie Thatchers berüchtigter Spruch "There is no such thing as society" keine Zweifel daran lässt, dass der Neoliberalismus längst jeden Begriff des Sozialen verloren hat und deshalb auch kein Verständnis für die Anderen mehr entwickeln kann.
So wie Fanon klargemacht hat, dass der Humanismus seiner Zeit nicht nur den Gegensatz zum europäischen Kolonialismus bildete, sondern beide - vermittelt über den Rassismus - aufeinander bezogen waren, so gilt es heute zu erkennen, dass es die irre Idee totaler Eigenverantwortung ist, die Reduzierung allen Lebens und aller Lebensbereiche auf unternehmerisches Handeln, die den immer krasser zutage tretenden Gegensatz zwischen der Betonung universeller Menschenrechte und dem faktischen Ausschluss von Menschen zulässt.
Um der nachkolonialen Verständigung den Boden zu bereiten, hat Fanon die Sprache des Kolonialismus angegriffen. Ebenso müsste heute zuallererst mit der Sprache des Neoliberalismus ins Gericht gegangen werden, soll die Idee des Dialoges noch eine Chance haben. Es ist höchste Zeit, eine neue Sprache zu finden, die Macht und Herrschaft in der gegenwärtigen Weltordnung zu beschreiben vermag.