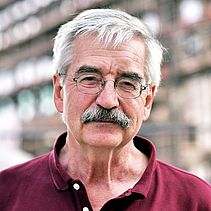Das Auseinanderfallen von Sprache und Wirklichkeit ist nichts, worauf allein Donald Trump ein Patent hätte. Auch europäische Politikerinnen und Politiker üben sich in Fake News. Angela Merkel beispielsweise, wenn sie im Wahlkampf mit humanitärer Geste tönt, dass sich Deutschland nicht einfach gegen Flüchtlinge abschotten und nicht einfach so weiter machen könne. Das klingt gut, steht aber im krassen Gegensatz zur aktuellen Politik Deutschlands, das sich wie nie zuvor abschottet und auf die Externalisierung aller aus der eigenen Lebensweise resultierenden Gefahren und Risiken setzt.
Es ist nicht neu, dass uns zur Legitimation politischer Macht allerlei Täuschungen zugemutet werden. Neu ist, dass solchen Irreführungen immer weniger widersprochen wird. Offenbar ist Zynismus zu einem Massenphänomen geworden, das längst auch weite Teile der Öffentlichkeit erfasst hat. Kaum jemand mehr ist von der Gerechtigkeit der globalen Verhältnisse überzeugt; aber viel zu viele haben sich mit dem Unrecht arrangiert und tun alles, um es zu stabilisieren. Die Konsequenzen, die daraus für das eigene Bewusstsein resultieren, sind fatal. Im Zynismus tritt an die Stelle des Mitgefühls die Lüge. Man weiß zwar noch um das Elend, das in der Welt herrscht, aber sieht die Elenden letztlich selbst für ihre Lage verantwortlich. Auf solchen Selbsttäuschungen wuchern schließlich auch die aggressiven Entgleisungen einschlägiger Politiker.
Etwa die von Franz-Michael Skjold Mellbin, dem Botschafter der Europäischen Union in Afghanistan, der die Frage, warum man Geflüchtete nach Afghanistan abschieben könne, Anfang April im französischen Fernsehkanal France24 so beantwortet hat: „Es ist ein sicherer Platz gemessen an der Sicherheit, die wir heute in der Welt erwarten können. Wir erleben groß angelegte Terrorangriffe auf Zivilsten in Europa, und wir erleben sie in Kabul. Das ist Teil des täglichen Risikos, mit dem wir heute alle zu leben haben.“ Die Menschenverachtung, die aus solchen Sätzen spricht, verspritzt ihr Gift in drei Richtungen. Sie verharmlost den Krieg in der Fremde und dramatisiert zugleich die Bedrohung des Eigenen; vor allem aber sorgt sie für die weitere Demoralisierung der Öffentlichkeit.
Schauen wir zunächst nach Afghanistan. Wie unsicher Afghanistan ist, wissen auch die in Kabul residierenden Diplomaten. Nur noch selten verlassen sie ihre militärisch gesicherten Gettos, und wenn sie es tun, dann nur in gepanzerten Fahrzeugen. Die Sicherheitsvorkehrungen, mit denen sich Ausländer in Afghanistan schützen, haben in den letzten Jahren systematisch zugenommen. Immer größere Anteile der als Aufbauhilfe deklarierten Unterstützungsleitungen fließen in den Bau von Mauern und Schutzräumen, in Kameraüberwachung, Schutzwesten etc. Gleichzeitig wächst die Zahl der „Geisterprojekte“, die nur noch auf dem Papier bestehen: Schulen beispielsweise, in denen schon lange kein Unterricht mehr stattfindet, aber als Beleg dafür herhalten müssen, dass Fluchtursachen bekämpft würden.
11.000 Zivilisten sind im letzten Jahr dem Krieg in Afghanistan zum Opfer gefallen; drei Millionen Binnenvertriebenen gibt es wieder. Die Lage sei „volatil“, so der UNHCR, die Aufnahmekapazitäten erschöpft, seit das Nachbarland Pakistan die letzten rund um Peshawar verbliebenen Flüchtlingsunterkünfte auflöst und inzwischen rund 600.000 Afghaninnen und Afghanen abgeschoben hat. Schon heute muss sich das vom Krieg zerrüttete Afghanistan um mehr Flüchtlinge kümmern als es das reiche Deutschland im „Sommer der Migration“ getan hat. Und nun sollen auch noch die 80.000 aus Europa hinzukommen, die „Ausreisepflichtigen“, wie sie im Beamtendeutsch heißen, zu deren Rücknahme die afghanische Regierung genötigt wurde.
Aufrüstung nach innen
Keiner hat eine Ahnung, wie das gehen soll. Denn wer heute nach Afghanistan abgeschoben wird, kommt in ein Land, in dem 40 Prozent der Leute nicht mehr wissen, wie sie sich morgen ernähren sollen; ein Land, das von der schlimmsten humanitären Krise seit 2001 geplagt wird, so das Internationale Komitee vom Roten Kreuz; ein Land, das im Human Development Index der Vereinten Nationen weit hinten auf Platz 169 von 175 rangiert. Ist das das Maß an Sicherheit, das wir heute in der Welt erwarten dürfen – Lebensumstände, die von Krieg und Elend charakterisiert sind? So absurd die Gleichsetzung von Afghanistan mit Europa ist, so infam ist die Botschaft, die aus ihr spricht. Denn wenn die Gefahren wirklich überall auf der Welt gleich sein sollen, dann legitimiert das nicht nur die Abschottung nach außen, sondern auch die sicherheitspolitische Aufrüstung nach innen.
Wenn auch in Europa Umstände wie in Afghanistan herrschen, dann gibt es für die weitere Militarisierung von Polizei, für großflächige Kameraüberwachung und automatisierte Gesichtserkennung, für Checkpoints und Straßensperren, für die Kriminalisierung von Protest und Demonstrationen, für das das Wegschließen von Auffälligen und schließlich für die Präsenz von Militär im Alltag kein Halten mehr. Dann gilt das, was sich so mancher europäische Innenminister insgeheim wohl schon lange wünscht: das Zurückdrängen von Bürger- und Menschenrechte zugunsten robuster Sicherheitspolitik. Ausgerechnet in Frankreich, das vielen als das Ursprungsland der Menschenrechte gilt, geht der Krieg gegen den Terror heute mit der systematischen Verletzung von Menschenrechten einher. Und ausgerechnet das liberale und weltoffene Hamburg musste kürzlich einen nie dagewesenen, die Bürgerrechte einschränkenden Polizeieinsatz über sich ergehen lassen, um ein Treffen von Politikern zu schützen, dessen Sinn sich niemandem mehr erschloss.
Wo Gefahren lauern, ist Handeln gefragt, keine Frage. Aber gerade die Dramatisierung von Gefahren sorgt dafür, dass der Raum für Politiken, die auf nachhaltige Veränderungen drängen, immer enger wird. Für ein politisches Engagement jedenfalls, das globale Gerechtigkeit und damit auch Korrekturen der eigenen Lebensweise zum Ziel hat, scheint es dort, wo die Sicherheit akut bedroht ist, keine Zeit zu geben. Es klingt absurd, aber eine Politik des „Weiter so!“ kann sich nicht zuletzt über der Dramatisierung ihrer Folgen weitere Zustimmung verschaffen. Es ist höchste Zeit, diesen dumm gewordenen Pragmatismus zu durchbrechen und in der Krise die Chance für eine Umkehr zu sehen. Voraussetzung dafür freilich ist die öffentlich virulent werdende Überzeugung, dass es auch anders geht, dass die bestehende Realität nicht die einzig mögliche ist und das „Böse“ aufgehalten werden kann. Im Massenzynismus der Gegenwart gehen solche ethisch-moralischen Positionen verloren. Man erkennt zwar noch das Versagen der Macht, sieht aber keine Chance, ihr Einhalt zu gebieten. Im Zynismus wird die Ohnmacht verinnerlicht; Krieg und soziale Verunsicherung werden zu einem „Teil des täglichen Risikos, mit dem wir heute alle zu leben haben“, so der EU-Botschafter in Afghanistan.
Die Wurzeln des Zynismus
Die zynische Grundstimmung der Gegenwart aber ist nicht vom Himmel gefallen: Sie hat ihre Wurzeln in der neoliberalen Umgestaltung der Welt, genauer: in der Auflösung einer auf Solidarität und Mitmenschlichkeit fußenden Gesellschaftlichkeit. Die Prekarisierung der Arbeits- und Lebensumstände, der tägliche Kampf aller gegen alle in einer zunehmend von Konkurrenz dominierten Gesellschaftlichkeit hat solche Reaktionsmustern verstärkt und ihnen schließlich auch die Aura von „Coolness“ gegeben. „Cool“ sein bedeutet, den Ausweg nicht mehr über ein öffentliches und gesellschaftlich organisiertes Drängen auf eine andere Zukunft zu suchen, sondern sich über die Schaffung individueller Autonomie inmitten gegenwärtigen Unrechts einzurichten. Unter solchen Umständen kann sich das Bemühen um Sicherheit immer nur noch um die eigene Sicherheit drehen: um Abschottung und ein „Weiter so!“.
„Wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Wir leben über die Verhältnisse anderer“, schreibt Stephan Lessenich in seinem Essay „Neben uns die Sintflut“, der im letzten Jahr erschienen ist. Es liegt auf der Hand, dass sich gegenüber dem Unrecht umso besser zynisch sein lässt, wie seine konkreten Auswirkungen unsichtbar bleiben und die negativen Folgen der eigenen imperialen Lebensweise externalisiert werden. Ins Wanken gerät der Zynismus erst, wenn die Fundamente der Selbsttäuschung ins Wanken geraten – wenn wir also erkennen, was Georg Schramm, Kabarettist und Kuratoriumsmitglied der medico-Stiftung, bereits vor einigen Jahren auf der Bühne als Rentner Lothar Dombrowski verkündet hat: „Wir sind die Sintflut.“
Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 3/2017. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!