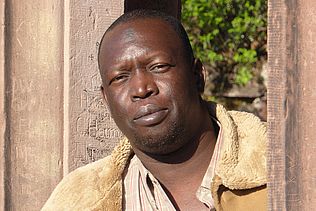Wer derzeit Einschätzungen zum politischen Geschehen im Sahel abgeben möchte, sieht sich mit äußerst widersprüchlichen und beunruhigenden Entwicklungen konfrontiert. Offensichtlich ist vor allem, dass der Geist des Aufbruchs verflogen ist, der nach den Putschen in Mali, Burkina Faso und Niger vor zwei Jahren vielerorts zu beobachten war. So erklärte ich im Herbst 2023 in einem Interview für medico, dass angesichts der engagierten und erwartungsvollen Stimmung in der Bevölkerung der Begriff ‚Demokratisierungsgürtel‘ passender sei als das in westlichen Medien gängige Narrativ vom ‚Putschgürtel‘.
Heute beurteilen viele Menschen im Sahel die Lage nüchterner. Eine Mehrheit unterstützt zwar weiterhin die Militärs, doch diese agieren immer autoritärer und begegnen offenem Widerspruch immer repressiver. Betroffen sind nicht nur Menschenrechtler wie der medico-Partner Moussa Tchangari vom Alternative Espaces Citoyens, der in Niger seit Dezember 2024 unter fragwürdigen Vorwürfen im Gefängnis sitzt. Oder der seit März 2025 inhaftierte Aktivist Miphal Ousmane Lakoande in Burkina Faso, prominenter Vertreter des Balai Citoyen ("Bürgerbesen"), jener Bewegung, die 2014 maßgeblich zum Sturz des Langzeitautokraten Blaise Compaoré beigetragen hat.
Auch die Terrorbekämpfung wird von internationalen Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch regelmäßig scharf kritisiert. Vor allem Gemeinschaften von Viehhirten der Fulbe in Burkina Faso sehen sich wegen vermeintlicher Unterstützung terroristischer Netzwerke regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen, wobei die meisten Menschen in Burkina Faso den in diesem Zusammenhang ebenfalls erhobenen Vorwurf "ethnischer Verfolgung" entschieden zurückweisen. Auch in Mali hat sich die politische Großwetterlage zugespitzt, nachdem am 14. Mai 2025 sämtliche Parteien per Dekret aufgelöst wurden und neue Parteien zukünftig nur noch unter streng definierten Bedingungen zugelassen werden sollen.
Entsprechend kritisch fallen die Reaktionen in der westlichen Öffentlichkeit aus. Viel Gehör findet etwa Abdourahmane Idrissa, ein international renommierter Sahel-Forscher, der kein gutes Haar an den Militärregierungen in Mali, Burkina Faso und Niger lässt: Er spricht davon, dass sich im Sahel eine "Herrschaft des Absurden" herausgebildet habe. Bereits 2012 sei in Mali mit einem ersten, rasch niedergeschlagenen Putsch die Ideologie des Souveränismus aufgetaucht. Diese sei kein positives politisches Projekt sondern ein nationalistisches Instrument zur Kontrolle der Massen, das alle Probleme inneren und vor allem äußeren Feinden anlasten würde – nicht zuletzt Frankreich. Konkret habe dies zur Suspendierung des republikanisch-institutionellen Rahmens und der Rechtsstaatlichkeit geführt, was seinerseits die Länder, so Idrissa, zu "faschistischen Regimen" mache, die als Beweis für ihre Souveränität laufend "rohe Taten" begingen, wozu er unter anderem den Austritt der drei Sahelländer aus der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS zählt.
Ambivalenzen statt Eindeutigkeit
Doch die Wirklichkeit ist komplexer, als es solche markigen Analysen vermuten lassen. Als ich zu Beginn des Jahres im Rahmen meiner zivilgesellschaftlichen Tätigkeit sieben Wochen in Mali und Burkina Faso war, begegneten mir völlig andere Stimmungslagen. In meinen Gesprächen erlebte ich keine wütenden Menschen, die dem Faschismus den roten Teppich ausrollen. Vielmehr hatte ich überwiegend mit nachdenklichen Zeitgenoss:innen zu tun, die die Entwicklungen im Sahel jeweils völlig unterschiedlich interpretierten. Von einem antidemokratischen und gewalttätig aufgeladenen Souveränismus war wenig zu spüren, genauso wenig wie von Glorifizierungen der Militärs. Gewiss, solche Haltungen gibt es, aber sie sind minoritär, auch wenn sie in den sozialen Netzwerken die Oberhand zu haben scheinen.
Bestimmend sind vielmehr Ambivalenzen, auch wenn diese nicht immer offen gezeigt werden: Leute, die unumwunden von ihren Schwierigkeiten im Alltag und ihren Verunsicherungen berichten, die aber auf keinen Fall zum früheren Status Quo zurückkehren möchten. Und die auch nicht verstehen können, dass westliche Akteure laufend von Russland als dem ultimativen Bösen reden. Russland verkaufe den Sahelländern in erster Linie Waffen, mit denen sie sich gegen Terrornetzwerke verteidigen könnten – also genau das, was der Ukraine mit Blick auf den russischen Angriffskriegs völlig selbstverständlich zugestanden würde. Ansonsten spiele Russland keine prominente Rolle – vor allem wirtschaftlich nicht. Diese Stimmungen spiegeln sich auch in Umfragen wider: In allen Ländern ist es weiterhin eine Mehrheit, die den aktuellen Kurs unterstützt – am stärksten wohl in Burkina Faso, wo die Militärs tatsächlich auf handfeste Erfolge verweisen können. Aber auch in Mali hat das Mali-Mètre – eine seit 2012 jährlich durchgeführte Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung – im Januar 2025 eine landesweite Zustimmung von 92 Prozent zur Militärregierung ermittelt.
Wie ist das zu verstehen? Kritiker:innen sprechen von Angst, Manipulation oder Opportunismus, die die Menschen zu treuen Gefolgsleuten machten. Doch das dürfte der Realität nicht gerecht werden, auch nicht den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, darunter Bauern und Bäuerinnen, Frauen in der Lebensmittelverarbeitung, Schneider und islamische Heiler. Sie haben nicht vergessen, dass es die schlechte Regierungsführung jener vom Westen unterstützten und heute als Opposition adressierten Parteien war, die die (Gewalt-)Krise im Sahel erst hervorgebracht hat – gemeint sind hiermit insbesondere Phänomene wie Korruption, Unterschlagung, Klientelismus, Misswirtschaft, Straflosigkeit oder Dekadenz. Die Bevölkerung wisse auch, dass sie keine schnellen Ergebnisse erwarten könne. So wurde der Ausbau des Stromnetzes – um nur eines der größten Konfliktthemen zu nennen – in den letzten 20 bis 30 Jahren systematisch vernachlässigt, nicht nur im Sahel.
Gleichzeitig sind aus Sicht meiner Gesprächspartner:innen auch zahlreiche Fortschritte zu vermelden: In der Korruptionsbekämpfung; bei der Erhöhung staatlicher Einnahmen durch konsequente Besteuerung, Zollpolitik etc.; bei der Neuausrichtung des Bergbauwesens zugunsten einer höheren Beteiligung der jeweiligen Länder an den Gewinnen; bei Investitionen unter anderem in soziale Infrastruktur und verarbeitende Industrie (etwa Tomaten und Gold in Burkina Faso); bei der Neuordnung entwicklungspolitischer Maßnahmen, sodass die konkreten Entscheidungen maßgeblich in der Verantwortung der jeweilige Regierungen und nicht mehr bei den sogenannten Geberländern liegen; in der Erinnerungspolitik durch antikoloniale Denkmäler und Straßenumbenennungen zugunsten afrikanischer Namensgeber; bei der Diversifizierung internationaler Partnerschaften unter den Stichworten von Souveränität und Multipolarität; und bei der Verbesserung der Sicherheitslage, die in allen drei Ländern als unbestritten gilt – trotz anderslautender Analysen westlich ausgerichteter Thinktanks. Sicherlich, die Erfolge sind nicht in allen Ländern gleichermaßen stark, oft sind sie nur in Ansätzen realisiert, aber sie sollten zur Kenntnis genommen werden. Selbst die Weltbank und der IWF haben Burkina Faso erst jüngst robuste Wirtschaftsdaten bescheinigt.
Mentalitätswandel
Niemand kann voraussagen, wohin sich der Sahel in den nächsten Jahren entwickeln wird – alle Szenarien sind denkbar. Gleichzeitig weisen viele Beobachter:innen darauf hin, dass sich bereits seit der Jahrtausendwende ein Mentalitätswandel in den jüngeren Generationen vollzieht, der zusammen mit ökonomischen Entwicklungen die geopolitischen Kräfteverhältnisse schrittweise zugunsten des Sahel verschieben wird.
In diesem Sinne hat bereits 2023 der aus Simbabwe stammende und in Bayreuth lehrende Sozialphilosoph Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni in einem Gastbeitrag für medico davon gesprochen, dass "die seit dem 15. Jahrhundert fortwährende Ära der westlichen Beherrschung der Welt zu einem Ende" komme und dass die Militärregierungen im Sahel mit Antonio Gramsci als "Morbiditätssymptome" eines "Interregnums" verstanden werden könnten, das heißt einer Scheidezeit, in der "das Alte noch Zeit zum Sterben benötigt, während das Neue eine gewisse Zeit zur Entfaltung bzw. zum Ersetzen des Alten braucht."