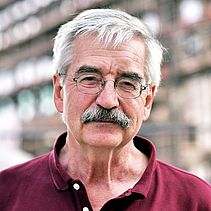Mit Blick auf die vielen Krisen, die in der Welt herrschen, hätte Politik heute eigentlich nur noch eine Chance: „Auf Sicht fahren“, nannte Angela Merkel das vor ein paar Jahren. So schlicht ein solches Regierungsprogramm anmutet, so weitreichend sind seine Konsequenzen.
Denn wenn Politik nicht mehr über ein Stochern im Nebel hinauskommt und sich nur noch von Krise zu Krise hangelt, verweist das nicht nur auf eine Art politischer Selbstaufgabe. Es bereitet auch den Boden für Verunsicherungen von dramatischem Ausmaß. Lässt sich all den Gefahren und Risiken, die in der Zukunft drohen, überhaupt noch etwas entgegensetzen? Ist die nächste Krise nicht unumgänglich? Und wenn, wer soll sich um die notwendigen Vorkehrungen kümmern, wenn Regierungen dazu nicht mehr imstande sind?
Resilienz als Allheilmittel
Es sind solche Fragen, die in den letzten Jahren die Attraktivität eines Konzeptes befördert haben, das mit dem schillernden Namen „Resilienz“ daherkommt. Die Idee, die damit verbunden ist, klingt einfach: Es geht um die Fähigkeit von Menschen und Systemen, Störungen von außen zu überstehen. Vielen gilt Resilienz heute als die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, als Allheilmittel für alle Gefahren, denen Menschen ausgesetzt sein können.
Resilienz ist Thema in der Erziehungsberatung und der Traumabehandlung, in den einschlägigen Ratgeberspalten der Yellow Press, aber auch in der Frage des Aufbaus von Gesundheitsdiensten in Westafrika, in den Trainingskursen für Führungskräfte, beim Schutz vor Burnout, vor dem Klimawandel und kriegerischer Gewalt, in der Katastrophenvorsorge, der Ökonomie und selbst in der Sicherheitspolitik.
Die Entpolitisierung des Begriffs
Ursprünglich stammt der Begriff Resilienz aus der Physik, genauer aus der Stoffkunde, und beschreibt die Fähigkeit eines Werkstoffs, auf Störungen, die von außen auf ihn einwirken, unbeschadet reagieren zu können. Das lateinische „resilire“ meint übersetzt „abprallen, zurückfedern“. Angesichts von Zukunftserwartungen, die von Chaos- und Bedrohungsszenarien geprägt sind, ist es gewiss vernünftig, Vorkehrungen zu treffen. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, die Widerstandkraft von Menschen zu stärken. Und natürlich ist es notwendig, Menschen in ihrem Bemühen zur Seite zu stehen, sich vor Katastrophen besser zu schützen.
Absurd aber wird es, wenn das Bemühen um Resilienz zur Rechtfertigung herhalten muss, um nichts mehr gegen die Ursachen von Krisen tun zu müssen. Genau das aber ist zunehmend der Fall. Die Idee der Resilienz, die in den Umwelt- und Sozialwissenschaften anfangs durchaus sinnvolle Beiträge geleistet hat, ist in den letzten Jahren mehr und mehr von jener Politik der Entpolitisierung vereinnahmt worden, die – indem sie „auf Sicht fährt“ – gar nicht mehr den Anspruch erhebt, Alternativen zur herrschenden Krisendynamik zu denken.
Resilienz statt Nachhaltigkeit
Matthias Horx, einer der Apologeten der neoliberalen Umgestaltung, hat das offen bekannt: „Resilienz wird in den nächsten Jahren den schönen Begriff der Nachhaltigkeit ablösen. Hinter der Nachhaltigkeit steckt eine alte Harmonie-Illusion, doch lebendige, evolutionäre Systeme bewegen sich immer an den Grenzlinien des Chaos.“
Von der Krisenbewältigung zum Krisenmanagement, von einer auf Veränderung drängenden Politik zum „Fahren auf Sicht“? Was Horx als „Harmonie-Illusion“ verunglimpft, ist die normative Dimension, die in der Idee der Nachhaltigkeit steckt. Nachhaltigkeit, wie auch immer verstanden, impliziert Wertvorstellungen, an denen sich politische, ökonomische und technologische Entscheidungen ausrichten sollen.
Vor allem in der Idee der nachhaltigen Entwicklung geht es um Vorstellungen, durch aktive Gestaltung der Verhältnisse menschenwürdige Lebensumstände zu schaffen und Gefahren zu minimieren. Ein solches normatives Konzept fehlt der Idee der Resilienz: Ihm geht es nicht mehr um gesellschaftliche Ideale, sondern um die Frage, wie sich Menschen und Systeme gegen Störungen, sprich: eine aus den Fugen geratene Welt, schützen können. Ihre Klammer ist nicht mehr das Bemühen um eine Korrektur ausbeuterischer und gewaltsamer Verhältnisse, sondern die Anpassung an einen offenbar unaufhaltsam, weil alternativlos, voranschreitenden Zerstörungsprozess.
Verantwortung der Einzelnen
Die Frage aber ist, ob das so sein muss; ob die viel beschworene Alternativlosigkeit, die inzwischen fast schon metaphysische Dimensionen angenommen hat, tatsächlich so alternativlos ist? Gerade der inflationäre Bezug auf Resilienz lässt erahnen, dass es nicht um die Stärkung von Widerstandskraft geht, sondern dass ganz andere Interessen im Spiel sind, legitimatorische und kommerzielle.
Denn wenn Resilienz eine Eigenschaft von Menschen bzw. Systemen ist, über die im Prinzip alle verfügen, die vielleicht nur ein wenig Training bzw. technische Verbesserung verlangt, dann können sich die Regierenden auch mehr und mehr ihrer gesellschaftspolitischen Schutzverpflichtung entziehen. Unter solchen Umständen kann sich ein komplett neues Staatsverständnis breitmachen. Eines, das die Verantwortung für die Bewältigung von Armut, die Folgen des Klimawandels, der grassierenden Gewalt an Subsysteme wie Familien, Kommunen, Nachbarschaften, Unternehmen und schließlich an jeden und jede einzelne abwälzt.
Vorkehrungen für kommende Krisen
Und so sind heute alle damit befasst, Vorkehrungen für kommende Krisen zu treffen: die Bewohner küstennaher Dörfer in Bangladesch, die auf Anregung von Entwicklungsexperten von der Hühner- auf die Entenzucht umstellen; Topmanager von Versicherungsgesellschaften, Banken und Fluglinien, die auf Tagungen über „Anreize für resilientes Investment“ nachdenken; die Weltgesundheitsorganisation, die sich für den Aufbau „resilienter Gesundheitssysteme“ stark macht, da sich die sozialen und politischen Umstände angeblich nicht verändern lassen; die US-Armee, die im Rahmen eines „Comprehensive Soldier Fitness“-Programms den resilienten Soldaten schaffen will, an dem alles abprallt, was die Kampfkraft mindern könnte; aber auch israelische Grundschüler, die anhand simulierter Terroranschläge üben, wie Angst durch Atemübungen und positive Gedanken bekämpft werden kann.
Aus dem herrschenden Diskurs ist Resilienz heute nicht mehr wegzudenken. Wissenschaftler erhöhen ihre Chance, Drittmittel zu ergattern, wenn es um Resilienz geht; Entwicklungsexperten, die mit Blick auf die prekären Verhältnisse in der Welt nicht allzu viele Erfolge vorzuweisen haben, freuen sich, eine neue Strategie gefunden zu haben; und einschlägige Unternehmen rechnen sich bereits Chancen für neue Geschäfte aus.
Risiken managen statt minimieren
Ein Beispiel: Eine von der staatlichen deutschen Entwicklungszusammenarbeit getragene „Globale Initiative Katastrophenrisikomanagement“ (GIKRM) fördert Netzwerke, in denen sich „Akteure aus Politik, Privatwirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenschließen, um maßgeschneiderte Lösungen im Bereich des Katastrophenrisikomanagement zu entwickeln“.
Bemerkenswert ist, dass im Namen der Initiative nicht mehr von Risikominderung, sondern von Risikomanagement die Rede ist. Entsprechend geht es in den Projekten nicht mehr um Alternativen zu den sklavenhaften Arbeitsbedingungen von Näherinnen in den Weltmarktfabriken der internationalen Textilbranche, sondern um die Ausrüstung der Fabrikgebäude mit Brandschutzmeldern.
Business as usual
Nicht mehr das Engagement gegen die wachsende soziale Ungleichheit steht im Vordergrund, sondern – in Kooperation mit der Tourismusbranche – die Schaffung von resilienten Hotels für Touristen. Ganz offen spricht die deutsche Initiative von der Chance, für Technologien „made in and with Germany“ den Markt zu öffnen. Die „resilience dividend“ bekommt so einen tieferen Sinn.
Und so entpuppt sich Resilienz als eine Art Knotenpunkt von deregulierter Ökonomie, neoliberal zugerichteter Subjektivität und einer Staatlichkeit, die nur noch den Status quo, und sei er noch so ungerecht, sichern will. Wenn sich alle „fit für die Katastrophe“ machen, wird die Idee einer Welt obsolet, in der die Verwirklichung und der Schutz der Menschenrechte eine öffentliche Aufgabe ist.
Resilienz macht es möglich, dass sich der herrschende Zerstörungsprozess noch in Zeiten größter Gefahr und Not als „Business as usual“ fortsetzen kann. Und eben darin steckt das Paradox heutiger Resilienz-Konzepte: Sie stabilisieren genau jene Verhältnisse, an deren prekärem Zustand sich das Bedürfnis nach Resilienz entzündet. Es ist ein höchst eigentümlicher Widerstandsbegriff, der in diesen Konzepten aufscheint – einer, den sich die herrschenden Verhältnisse zunutze machen, um sich selbst abzusichern. Einem solchen Widerstandsbegriff sollten wir widerstehen.
Dieser Beitrag erschien zuerst im Rundschreiben 2/2015. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!