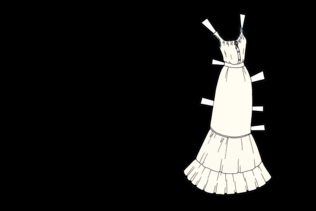Insbesondere nach den sozialen Revolten 2018 in Nicaragua treibt viele die Frage um, wie es sein kann, dass aus ehemals linken Hoffnungsträgern für soziale Bewegungen weltweit heute autoritäre, zutiefst antifeministische Regime werden konnten. Der frühere Revolutionär Daniel Ortega und seine Frau und Vize Rosario Murillo haben Nicaragua nach der Niederschlagung des zivilen Aufstands 2018 fest im Würgegriff. Aber das autoritäre Projekt geht über ideologische Grenzen hinweg. In El Salvador beseitigt der neoliberale Millennial Nayib Bukele zielstrebig alle juristischen und politischen Hindernisse einer Herrschaft, in der sich staatliche und kriminelle Eliten verschränken. In Guatemala hat das Wahlgericht kurzerhand eine Neuauszählung der ersten Runde von Präsidentschafts- und Regionalwahlen angeordnet, nachdem überraschend progressive Kandidat*innen, die nicht Teil des sogenannten Paktes der Korrupten sind, sehr gute Ergebnisse erzielten. Während das Recht indigener Gemeinden auf Land gewaltsam negiert wird, bleibt der guatemaltekische Staat von korrupten Cliquen gekapert.
Wie lässt sich die politische Kultur des Autoritarismus, die durch die Revolution in Nicaragua hindurch erhalten blieb, überwinden? Was lässt sich der patriarchalen Herrschaft in Guatemala entgegensetzen? Braucht es neue Formen des Widerstands, die bereits in sich die Kritik der politischen Form tragen, gegen die sie sich wenden?
Darüber haben wir auf einer Veranstaltung Ende April in Berlin mit Lucía Ixchiu aus Guatemala und Yerling Aguilera und Carlos Vázquez* aus Nicaragua diskutiert. Sie blicken aus der Perspektive des Exils bzw. der Diaspora auf ihre zentralamerikanische Heimat und beschreiben auch die Ambivalenz von Möglichkeit und Verletzung, die in der erzwungenen Distanz liegt.
medico: Vor fünf Jahren kam es in Nicaragua wegen einer geplanten Rentenreform zu massiven Protesten. Angeführt von Studierenden, schlossen sich große Teile der Gesellschaft an. Die Proteste wurden brutal niedergeschlagen, viele Menschen starben. Bis sie im Februar nach Washington ausgeflogen wurden, enteignet und ihrer Staatsangehörigkeit beraubt wurden, saßen Dutzende politische Gefangene noch unter menschenunwürdigen Bedingungen im Gefängnis. Daniel Ortega, der während der sandinistischen Revolution selbst an der Seite derjenigen gekämpft hat, die er später in den Knast steckte, machte in den vielen Jahren seiner Amtszeit keinen Hehl aus seinem autoritären Bestreben. Ortegas Weg in die Diktatur ist am weitesten fortgeschritten, wo seht ihr Kontinuitäten autoritärer Herrschaft in Zentralamerika, worin unterscheiden sich die Länder?
Carlos Vázquez: Unsere Länder Nicaragua, El Salvador und Guatemala haben lange und äußerst blutige Kriege durchlebt, darunter auch jener, in dem der Völkermord an indigenen Gemeinschaften in Guatemala stattfand. In Nicaragua gab es zunächst einen Befreiungskrieg gegen eine Diktatur, dann einen Bürgerkrieg – einen sehr komplexen Krieg gegen die Konterrevolution, in dem auch die Vereinigten Staaten als Finanzier der Konterrevolution eine sehr wichtige Rolle spielten. Die Revolutionsregierung beging auch selbst Willkür, Fehler und Menschenrechtsverletzungen, die wiederum die Konterrevolution anheizten. Auch in El Salvador gab es einen langen Krieg, in dem es der Guerilla nicht gelang, die Macht zu übernehmen. Ich finde, unsere Länder haben viele historische, soziale, kulturelle und politische Gemeinsamkeiten, aber gleichzeitig auch deutliche Unterschiede.
Häufig ist die Rede von einer Entwicklung eines noch irgendwie verniedlichten „Danielismus“ hin zum knallharten „Orteguismus“. Gemeint ist die Festigung der Alleinherrschaft der Ortega-Familie, die sich zentrale staatliche und nicht-staatliche Institutionen angeeignet hat – inklusive eines durch und durch konservativen Diskurses über Familie und Nation. Einen Personenkult sehen wir auch in El Salvador, wo Präsident Nayib Bukele seit über einem Jahr im Ausnahmezustand regiert, der Menschenrechtsverletzungen und staatliche Gewalt normalisiert. Bukele gibt sich volksnah, tritt in Jeans und Basecap auf, setzt auf Bitcoin und Modernisierungsversprechen. Er und Ortega unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Dennoch stellt sich die Frage, was hat es mit dem dynastischen Charakter und Regierungsstil, der sich um Einzelpersonen zentriert, auf sich?
Carlos Vázquez: In Nicaragua ist der dynastische Charakter der Macht tief verwurzelt und stellt auch eine Ironie der Geschichte dar, denn er erinnert an die dynastische Diktatur von Anastasio Somoza in den 1960er und 1970er Jahren. Der dynastische Charakter der Macht in Nicaragua erklärt sich aus der enormen Macht, die Ortega seiner Frau Rosario Murillo, Vizepräsidentin und Ministerin für Kommunikation, übertragen hat. Sie ist Regierungschefin und er das Staatsoberhaupt. Seit 2018 versuchen sie, die Macht innerhalb der Dynastie, innerhalb der Familie zu verteilen, weil sie politisch nur ihrer Familie vertrauen. Nicht einmal die Verbündeten der Revolution oder die neuen Kader erhalten Macht, weil sie nur ihrer Blutsverwandtschaft vertrauen.

Das ist zum Beispiel in Guatemala anders, wo es bisher keinen Präsidenten gab, der länger als 10 Jahre an der Macht war. Das soll nicht heißen, dass es in Guatemala keine autoritären Regierungen gab. Vielmehr drückt sich der dortige Autoritarismus in einer anderen Logik aus, vor allem in ihrem Verhältnis zu Machtgruppen. Und in El Salvador haben wir jetzt die Entwicklung einer autoritären, personalistischen Macht, in der auch die Familie eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich denke, das hängt stark mit dem Ansprechen von konservativen und traditionellen Werten zusammen.
Wie schätzt ihr das für Guatemala ein? Was lässt sich angesichts der massiven Landenteignung, der brutalen Vertreibung und des Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung über Autoritarismus und koloniale Kontinuitäten in Guatemala sagen? Ist die Zerstörung der Bedingungen für ein würdiges Leben ein autoritäres Projekt unter neo-kolonialen und patriarchalen Vorzeichen?
Lucía Ixchiu: Man kann Guatemala nicht begreifen, ohne den kolonialen Prozess und die Gründung des guatemaltekischen Nationalstaates zu verstehen. Zunächst ist es meines Erachtens wichtig, Folgendes festzuhalten: Seit mehr als 531 Jahren herrscht in Guatemala eine oligarchische Diktatur kolonialen Ursprungs, die mit lokalen patriarchalischen Systemen verschränkt ist. Die koloniale Enteignung dauert bis zum heutigen Tag an. Guatemala ist ein kolonialer Besitz, der nach wie vor durch Beziehungen der Sklaverei und Enteignung in indigenen Gebieten funktioniert. Heute ist dies nicht nur eine Erzählung über die Vergangenheit.
Guatemala, verstanden als Nationalstaat, besteht seit kaum 200 Jahren; dieser Staat wurde unter Ausschluss der großen Mehrheiten, der indigenen Völker, gegründet. Der Kolonialismus ist kein Diskurs, der auf Ressentiments der indigenen Völker beruht. Kolonialismus ist unser tägliches Leben, die Tatsache, dass wir keinen Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, zu den grundlegendsten Dingen haben, die ein menschliches Leben würdig machen. Das meinen wir, wenn wir von autoritären Regimen sprechen, deren kolonialer Ursprung fortwirkt.
Dieses Regime hat sich vor kurzem als Demokratie getarnt: Auf den kolonialen Völkermord folgten staatliche Diktaturen. Dann kamen die Völkermorde in unseren Gebieten, die eine Kontinuität mit den mehr als 50 Millionen Toten während des gesamten Kolonialprozesses in unseren Gebieten, im Abya Yala[1], darstellen. Und dann kam die Demokratie, nach Unterzeichnung der Friedensabkommen im Jahr 1996. Doch was bedeutete das für unsere Völker? Die permanente Enteignung durch den extraktivistischen Neoliberalismus und westliche Interessen. Genau darum geht es bei Unterdrückungssystemen und autoritären Regimen. Für uns als indigene Völker ist dies die Bedeutung der Demokratie. Der einzige Ausdruck des Staates, den wir kennen, ist der Genozid.
“Patria libre o morir”, also „Freies Vaterland oder Sterben“ ist ein bekannter und häufig skandierter Slogan aus der Zeit der sandinistischen Revolution. Darin verbirgt sich auch ein Narrativ der Aufopferung als elementarer Bestandteil des Kampfes. Dieses Narrativ dominiert und verdrängt den vielfältigen, häufig unsichtbaren Widerstand gegen Gewaltherrschaft. Aus einer patriarchatskritischen und dekolonialen Perspektive gedacht: Zahlen wir heute auch den Preis für eine revolutionäre Idee, die vor allem darin bestand, die Macht im Staat zu übernehmen? Wo können soziale Bewegungen an die Erfahrungen von damals anknüpfen, wo müssen sie sich abgrenzen und neu erfinden?
Yerling Aguilera: Die sozialen Proteste in Nicaragua gehen in gewisser Weise auf bestimmte historische Entwicklungen zurück, und dabei blieb die Frage der sandinistischen Revolution nicht unbeachtet. Elemente davon wurden wieder aufgegriffen. Damals warb die Revolution mit dem Slogan „Freies Vaterland oder Sterben“ für Opferbereitschaft und die Notwendigkeit, für Ideale zu sterben. Die sozialen Proteste in Nicaragua haben diesen Spruch aufgegriffen und in „Patria libre para vivir“ (Freies Vaterland, um zu leben) umgewandelt. Leben bedeutet in erster Linie, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Denn der Feminismus betont ja auch das Recht, für sich selbst zu sorgen, das eigene Leben zu retten und zurückzutreten, wenn es nötig ist. Mein eigenes Leben ist auch wichtig und ich muss es nicht unbedingt einem abstrakten Projekt opfern, dessen Ausgang wir noch gar nicht kennen.
Die Revolution ist also letztlich eine Abstraktion geworden. Und wir fragen: Revolution für wen? Ok, ja zur Revolution, aber wer lebt sie? Wer genießt ihre Früchte? Die Umformulierung des Slogans ist daher auch eine Kritik an dem Projekt und seiner Agenda. Denn vor allem Frauen sind darin oft nicht vertreten. Und als Frau fragt man sich zu Recht: Warum soll ich für etwas sterben, in dem ich nicht vertreten bin? Weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich als Mensch diese Revolution erleben werde.
Wir plädieren also für eine Abkehr von der Politik als Abstraktion hin zu einer Politik, die mit dem Subjekt, mit dem Persönlichen und vor allem mit der Verteidigung des Lebens zu tun hat – jedoch nicht im konservativen Sinne der Abtreibungsgegner*innen, sondern im Sinne des Rechts auf ein würdiges Leben. „Leben“ in diesem Sinne hinterfragt auch den Mythos des heroischen, starken Guerillakämpfers, der sein Leben für das Vaterland opfert. Heimat und Revolution sind Abstraktionen, die nicht unbedingt mit dem Wunsch zu leben, mit dem Leben selbst verbunden sind.
Was denkst Du als indigene Aktivistin und Teil der Klimabewegungen in Guatemala zu der Frage nach Leerstellen in traditionellen linken Bewegungen, Lucía?
Lucía Ixchiu: Ich würde sogar noch weiter gehen. Mit Dekolonisierung meinen wir die Überwindung der Vorstellung, dass der Mensch im Mittelpunkt des Lebens steht. Der Mensch ist eher nur Teil im Lebensnetz. Für mich ist das ein grundlegendes Prinzip des antikolonialen Denkens. Ich stehe sozialen Bewegungen im Allgemeinen sehr kritisch gegenüber. Denn ich denke, dass in dem Bild des Aktivisten als Märtyrer ein sehr tiefes koloniales Erbe steckt. Dieses Bild des Aktivisten, der leidet, der gefoltert wird, der ins Exil gehen muss usw., stellt das Leiden in den Vordergrund, und das ist für mich sehr christlich und daher zutiefst kolonial.
Dekolonisieren bedeutet also, zur Erde zurückzukehren, zu verstehen, dass wir von der Erde kommen, dass es andere Wege gibt, die Welt zu sehen und uns zu organisieren. Ich stamme aus einem Quiché-Volk, was übersetzt „viele Bäume“ bedeutet. Das heißt, dass wir Bäume als unsere Vorfahren betrachten. Wenn wir einen Baum fällen, erweisen wir der gesamten Menschheit, der biologischen Vielfalt als Ganzes, eine tiefe Ehre. Für mich bedeutet Dekolonisieren genau das, jenseits jeglicher akademischer Theorie. Ich musste kein einziges Buch lesen, um zu dekolonisieren und zu verstehen, was die grundlegenden Prozesse der sozialen Kämpfe sind, über die wir hier sprechen. Revolutionäre Prozesse beginnen bereits im Magen – mit dem, was wir essen. Die Revolution fängt bei uns selbst an, sie ist kein Massendiskurs, sondern eine elementare, gemeinschaftliche Frage. Sie fängt im Kleinen an.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir sind es gewöhnt, den politischen Kontext von Siegen und Triumphen her zu analysieren. Müssen wir lernen, Revolution und politische Strategien anders zu denken? Aber wenn wir es nicht von den Erfolgen aus analysieren, von wo dann?
Carlos Vázquez: Ich denke, wir sollten uns dabei nicht nur auf das Ende, auf das Ergebnis konzentrieren, sondern auf die Art und Weise, wie wir kämpfen und wie wir uns artikulieren. So gesehen kann eine Niederlage ein Moment der Reflexion und Umstrukturierung sein. Selbstverständlich ist es nicht schön, eine Niederlage zu erleben, da sie mit Leid, Verzweiflung und Traurigkeit verbunden ist. Doch im Verborgenen kann sie eine positive Veränderung bewirken. Ich denke, dass dies eine Möglichkeit sein kann, den Kampf zu betrachten, ohne sich auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren, nämlich den des Sieges.
Auf gewisse Weise tragen wir in Nicaragua die Bürde dieser siegreichen Revolution, einer der drei bewaffneten Revolutionen (neben der kubanischen und der mexikanischen), die in Lateinamerika erfolgreich waren. Auf der einen Seite stehen die Enttäuschten, die Rechten oder die Rechtsextremen, die versuchen, die Bedeutung dieser Revolution auszulöschen oder zu delegitimieren. Für sie ist die Revolution die Wurzel aller Probleme in Nicaragua. Auf der anderen stehen diejenigen, die die Revolution romantisieren. Zwischen diesen beiden Gruppen ist es sehr schwierig, eine kritische Perspektive der Revolution zu entwickeln, die diese als ein authentisches Emanzipationsprojekt auffasst, dem es gelungen ist, Hunderttausende von Menschen zu mobilisieren und die einfachen Leute in den Mittelpunkt zu stellen. Die aber auch die Fehler, Missbräuche und den Autoritarismus anerkennt. Diese Perspektive muss jedoch auch die vielen Fehler, Missbräuche und den Autoritarismus anerkennen, das alles darf nicht geleugnet werden. Wir müssen uns darauf einigen, dass es ein legitimer Kampf für die Abschaffung einer Diktatur war. Eine Diktatur, die übrigens alles andere als angenehm war.
Yerling, Du hast dich intensiv mit Protestformen und Beziehungsweisen während und nach den Protesten in Nicaragua beschäftigt. Wenn es nicht um die Eroberung des Staates geht, worum geht es dann?
Yerling Aguilera: In den letzten Jahren haben wir in Kolumbien, Nicaragua und Chile eine Welle von Demonstrationen erlebt, die sich vielmehr an einer Bewegung destituierenden Charakters orientieren. Das heißt, eine Bewegung, die auf den Sturz der Regierung abzielt, aber nicht unbedingt auf die Machtergreifung. Diese Proteste sind Ausdruck eines politischen Wandels, der den Staat nicht mehr als emanzipatorische Institution und auch nicht als Mittel zur Veränderung der Verhältnisse sieht. Schließlich hat die jüngste Geschichte gezeigt, dass linke Regierungen, sobald sie an der Macht sind, nicht mehr auf die Forderungen eingehen, die sie an die Macht gebracht haben. Und genau darum geht es in dieser Bewegung: Dass sie nicht zu einem bloßen Instrument zur Eroberung der Macht wird.
In diesem Sinne lohnt sich ein Blick auf die Geschichte der Frauenbewegung und der Umweltbewegung: Sie brauchten keine politische Partei zu werden oder die Macht im Staat zu übernehmen, um wirklichen Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Agenda der sozialen Bewegungen zu erlangen. So ist in vielen Ländern die Frage der Entkriminalisierung der Abtreibung nicht durch den Staat oder seine politischen Parteien, sondern durch die Stärke der Frauenbewegung in den Vordergrund gerückt. Dies ist auch ein Merkmal der blau-weißen Bewegung, wie sie damals genannt wurde: Es handelte sich nicht um eine Bewegung, die die Gründung einer politischen Partei oder die Eroberung der Macht zum Ziel hat.
Die massiven Proteste, Straßenblockaden, Uni-Besetzungen von 2018 forderten die politischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten in Nicaragua grundlegend heraus. Sie öffneten völlig neue Horizonte, über das Politische, über Formen des Widerstandes und auch über die Frage nach dem politischen Subjekt nachzudenken. Bezugnehmend auf sie und gleichzeitig in Abgrenzung zu den Zeiten der Revolution wurden andere Formen der politischen Organisation und des Widerstandes betont. Müssen wir eine bestimmte politische Kultur „verlernen“?
Lucía Ixchiu: Soziale Bewegungen sind so etwas wie ein Wegbereiter des sozialen Wandels. Das heißt, unabhängig davon, ob diese Bewegungen an die Macht kommen oder verschwinden, sind sie in der Lage, die Subjektivität zu beeinflussen; sie haben das Potenzial, das Narrativ zu verändern, das wiederum die Grundlage für Veränderungen auf der mikropolitischen Ebene bildet. Dieser Aspekt könnte unbemerkt bleiben, wenn wir soziale Proteste weiterhin in einem traditionellen Rahmen von Erfolg und Misserfolg analysieren. Dabei besteht die Gefahr, die neuen Beziehungen zu übersehen, die sich auf der mikropolitischen Ebene abzeichnen. Ich bin der Meinung, dass man kleine Ereignisse nicht kleinreden sollte, da sie uns etwas darüber vermitteln können, wie man die Gesellschaft neu denkt und wie man sie umgestalten kann. Jenseits der „großen Erfolge“, wie der Gründung einer politischen Partei oder der Eroberung der Macht, müssen wir uns mit den Spuren befassen, die die sozialen Bewegungen hinterlassen.
Carlos Vázquez: Es mag sehr romantisch klingen, aber ich mag diesen Spruch, den ich vor einiger Zeit gehört habe: „Ein Lied macht keine Revolution, aber es inspiriert sie, denn es inspiriert Freude“. Und diese Freude war in diesen Monaten April und Mai 2018 trotz des Schmerzes, der Traurigkeit und der Anspannung präsent; diese Freude zeigte sich beim Tragen von Masken für die traditionellen Tänze in Masaya, beim Tanzen zu traditioneller nicaraguanischer Musik. Das war für uns auch eine Art, uns mit den Geschehnissen in Nicaragua zu verbinden. Um irgendwie dabei zu sein. Es sind genau diese Widerstandsräume, die für Ortega und Murillo am schwierigsten zu beherrschen sind. Es ist kein Zufall, dass so viele Musiker*innen und Künstler*innen inhaftiert sind oder waren, sogar auch in den letzten Monaten.
Ich glaube, es war für die Regierung Ortega und Murillo sehr schwer zu begreifen, dass die Symbole der Revolution plötzlich gegen sie verwendet wurden. Ein Beispiel dafür ist die Umformulierung des Slogans „Freies Vaterland, um zu leben“. In gewisser Weise bedeutete dies die Wiederbelebung des alten Slogans, aber gleichzeitig auch seine Kritik. Er wurde also quasi zu einem politischen Spannungsfeld.
Lucía, die Praxis deines Kollektivs, Festivales Solidarios, geht in eine ähnliche Richtung. Ihr seid ein Kollektiv indigener Künstler*innen, Journalist*innen und Wissenschaftler*innen, die zu Erinnerungsarbeit, Landverteidigung und politischer Gefangenschaft arbeiten. Dazu organisiert ihr kleine Festivals und Kulturveranstaltungen in indigenen Gemeinden. Man könnte vielleicht sagen, dass eure Praxis vor allem auf Kunst und Kultur anstatt auf Ideologie setzt. Wie kamt ihr dazu und braucht es andere Formen des Widerstandes?
Lucía Ixchiu: Im Jahr 2012 hat die guatemaltekische Armee mein Dorf massakriert. Das ist nichts Neues, denn heutzutage ist das Töten indigener Völker fast ein Sport, der völlig ungestraft bleibt. Ich erinnere mich, als mein Partner und ich und andere Menschen darüber überlegten, wie wir auf diese strukturelle Gewalt reagieren könnten, beschlossen wir, Kunst als Antwort einzusetzen: Ausgehend von der Antikolonialität, für das Recht auf Freude und im Kampf gegen die jüdisch-christliche Vorstellung, dass wir nur aus Leid kämpfen müssen. Deshalb haben wir beschlossen, Kunstkarawanen zu organisieren, um die Kunst zu den Orten des indigenen Widerstands und der Verteidigung des Territoriums und der historischen Erinnerung zu bringen. So versuchen wir, die indigenen Völker anders zu würdigen: weil wir indigene Völker bunt sind und gerade deshalb auch fröhlich. Wir sind viel mehr als Leidende, viel mehr als Opfer des Kolonialismus, die Mitgefühl bedürfen. Darum sind wir hier. Ich bin niemandes Opfer, ich bin das Subjekt meiner Geschichte. Und ich bin hier, weil ich mich entschieden habe, in einem kolonialisierten Land zu kämpfen, was ein sehr hohes politisches Risiko birgt: Tod, Gefängnis oder Exil.
Wenn du mich also fragst, was ich als Widerstand begreife, kann ich dir sagen: Wir indigenen Völker haben es satt, Widerstand zu leisten, wir wollen leben dürfen. Wir wollen in Frieden leben, so einfach ist das. Das haben mir meine Eltern beigebracht, dafür haben meine Großeltern gekämpft. Ich gehöre einer indigenen Organisation an, die älter ist als der guatemaltekische Nationalstaat. Diese Organisation schützt 320.000 Hektar Gemeindewald, eines der wichtigsten Wasseranreicherungsgebiete in Mesoamerika. Dieser Wald wurde durch die Gemeinschaftsarbeit unserer Organisation erhalten. Die wichtigsten Flüsse mehrerer mesoamerikanischer Länder haben hier ihre Quelle. Wir wollen, dass die Flüsse frei fließen.
Wir definieren uns durch Freude und lieben Farben. An dieser Stelle möchte ich eine Erkenntnis aus meiner jüngsten Reise nach Costa Rica mit euch teilen. Dort habe ich viele Dinge gelernt und andere Dinge, die ich zu wissen glaubte, in Frage gestellt. Das Exil hat mich als Mensch verändert. Die nicaraguanische Gemeinschaft in Costa Rica hat mich und meinen Partner herzlich aufgenommen. Von den nicaraguanischen Brüdern und Schwestern im Exil in Costa Rica habe ich gelernt, dass Exil auch heißt, Spaß am Leben zu haben, zu feiern und Reggaeton tanzen. Es mag seltsam klingen, aber dabei geht es ums Tanzen, darum, den Körper zu bewegen. Es geht ums Lachen. Es geht darum, unsere Realität anders anzugehen. Für mich war dies eine äußerst wertvolle Lebenslektion. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich diese nicaraguanischen Brüder und Schwestern kennengelernt habe.
Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Runden Tisch Zentralamerika und dem fdcl statt und wurde moderiert von Jana Flörchinger.
Carlos Vázquez* ist Politologe und seit einigen Jahren in der nicaraguanischen Diaspora in Europa aktiv. Aus Angst vor Repressalien gegen seine Familie in Nicaragua möchte er seinen Namen nicht veröffentlichen.
Lucía Ixchiu istMaya K'iche, Künstlerin, Architektin von Beruf und lebt seit März 2021 im Exil in Bilbao. Sie ist Teil des Kollektivs Festivales Solidarios, einer Gruppe indigener Künstler*innen, Journalist*innen und Wissenschaftler*innen, die zu Erinnerungsarbeit, Landverteidigung und politischer Gefangenschaft arbeitet. Lucía ist in Totonicapán in Guatemala aufgewachsen, wo 2012 bei Protesten gegen weitreichende Verfassungsänderungen XX indigene Demonstrant*innen von Polizei und Militär getötet wurden.
Yerling Aguilera ist Soziologin und lehrte an der Polytechnischen Universität in Nicaragua. Während der Protestbewegung gegen das Ortega-Regime 2018 war sie Teil verschiedener Bündnisse und Kollektive, weshalb sie noch im selben Jahr ins Exil nach Spanien gehen musste. Heute lebt sie in Spanien. In einem kürzlich erschienenen Essay mit dem Titel “Andere Formen des Kämpfens sind möglich” beschreibt sie basierend auf Interviews, wie die Revolte 2018 ausgehend von Solidarität, Autonomie und Horizontalität organisiert werden konnte und welche Formen des Widerstands, von Revolution und politischer Subjektivität damit einhergehen.
[1] Abya Yala bzw. Abiayala (aus dem Guna) bedeutet übersetzt „Land in voller Reife, gerettetes Land“ und wird als politische Bezeichnung für den amerikanischen Doppelkontinent verwendet.
Übersetzung: Benjamín Cortés