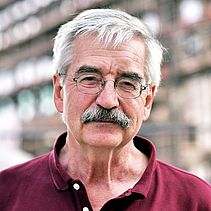In einem sind sich rechte Populisten mit den herrschenden Wirtschaftseliten einig: Beide pfeifen auf Humanität und Solidarität. Empathisches Mitfühlen mit anderen ist nicht deren Sache. Die einen suchen ihr Heil in einer wahnhaft konstruierten „Identität“, die alles Fremde ausgrenzt; die anderen verschanzen sich in sicherheitstechnologisch hochgerüsteten „gated communities“. Der Hass, mit dem rechtspopulistische Bewegungen auf alles Nicht-Identische reagieren, korrespondiert mit der Verachtung, die die Privilegierten für die gesellschaftlichen Verlierer und Ausgegrenzten empfinden. Die Lage wäre aussichtslos, wenn nicht diejenigen, die auf Ausgrenzung und Abschottung setzen, eine Minderheit wären.
Genau das aber ist der Fall. Empathie und Solidarität sind noch immer Werte, die von der Mehrheit der Leute hoch geschätzt werden. Das zeigte sich in der breit getragenen Willkommenskultur der zurückliegenden Monate, es zeigt sich in der ungebrochenen Bereitschaft, anderen beizustehen, im vielfältigen sozialen Engagement, aber auch in Umfragen, die keinen Zweifel daran lassen, dass die Mehrheit nach wie vor von einer solidarisch finanzierten öffentlichen Daseinsvorsorge überzeugt ist, die auch und gerade denen zugutekommt, die nichts haben.
„Wenn es uns gelänge zu zeigen, dass es auch anders geht, dann hätten wir schon viel geleistet.“
Paul Parin, 2008
Die Vorstellung, dass Bildung, Gesundheit, Kultur und all die anderen für das Zusammenleben von Menschen so wichtigen Gemeingüter unbedingt privatisiert werden müssten, entspringt nicht dem Wunsch und der Erfahrung der Leute. Das neoliberale Credo, es sei erst dann an alle gedacht, wenn jede und jeder an sich selbst denkt, ist nie unwidersprochen geblieben. Und dies trotz des enormen Aufwandes, mit dem Wirtschaftsführer, Politiker, Experten und Medien in den zurückliegenden drei Jahrzehnten versucht haben, die Auslieferung des in solchen Gemeingütern steckenden öffentlichen Eigentums an private Investoren als alternativlos erscheinen zu lassen.
Dass es auch anders geht, zeigt sich im Drängen auf Offenheit und Teilhabe. Es ist konstitutiv für das Mitfühlen und steckt, so paradox es klingt, auch im Leiden selbst. Die Utopie jedenfalls speist sich nicht aus abstrakten Idealen, sondern stets aus dem Aufbegehren gegen das mit dem Leiden verbundene Unrecht.
Es sind viele kleine und große Aktionen, Projekte und Handlungsstränge, die das Diktum der Alternativlosigkeit seit langem schon Lügen strafen. Nicht immer aber werden sie ausreichend wahrgenommen und mitunter von ihren Akteuren selbst missverstanden. Das andere lebt beispielweise im Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die ein von Schließung bedrohtes öffentliches Freibad in Eigenregie weiterführen, um es auch weiterhin für alle zugänglich zu halten; es zeigt sich in Theatergruppen, die ihre Bühne für Migrantinnen und Migranten geöffnet und dabei den Raum für jenen Perspektivwechsel geschaffen haben, der offene Begegnungen auszeichnet; es zeigt sich im Nachdenken von engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über Möglichkeiten der Transformation der herrschenden „imperialen Lebensweise“; es lebt in den Solidaritätskliniken Griechenlands, die all denen zur Seite stehen, die auf Druck der EU aus der öffentlichen Versorgung herausgefallen sind; es zeigt sich in den Kampagnen südafrikanischer Rechtsanwälte, die von den Behörden verlangen, endlich für angemessen ausgestattete Schulgebäude zu sorgen, und lebt in den Friedensmärschen israelischer Frauen. Weltweit zeigen Initiativen, dass es auch anders geht; Initiativen getragen von Menschen, die weder das eigene noch das Leiden der anderen akzeptieren wollen und daraus die Kraft schöpfen, auf Veränderungen zu drängen.
Inseln der Vernunft
Gemessen an der Vielfalt und Breite des Engagements für Humanität und Solidarität müsste einen das rückwärtsgewandte Geraune der Rechtspopulisten nicht weiter Bange machen. Und doch ist die Sorge nicht von der Hand zu weisen, dass sich der gesellschaftliche Rechtsruck fortsetzen und Hass und Gewalt zunehmen könnten. Viele fragen sich, ob angesichts der Erfolge von Trump, Marine Le Pen, der AFD nicht ganz anderes zu leisten wäre, als sich für den Erhalt eines Freibades, für offene Theaterarbeit, für die Versorgung griechischer Diabetespatienten, die Instandsetzung von Schultoiletten in Südafrika, etc. stark zu machen. Erfordern die prekären Umstände, die in der Welt herrschen, nicht mehr, als sich im Lokalen für Alternativen zu engagieren?
Und genau hier liegt das Missverständnis, denn all das ist notwendig, um für offene und solidarische Lebensumstände zu kämpfen. In einer in Irrationalität versinkenden Welt gilt es, Inseln der Vernunft zu schaffen. Und so ist es höchste Zeit, dem Grundsatz „Global denken, lokal handeln“ auch im sozialpolitischen Handeln Geltung zur verschaffen. Es gilt zu erkennen, dass das jeweils eigene, das lokale Engagement mit dem der anderen in aller Welt in Beziehung steht. Lokale Akteure, seien es nun Mieterkollektive, Flüchtlingsinitiativen, Kirchengemeinden oder attac-Gruppen, gewinnen an Stärke, wenn sie sich als Teil eines weltweiten Streitens für ein globales Projekt begreifen, das die universelle Verwirklichung der Menschenrechte zum Ziel hat.
Dabei meint das menschenrechtliche Prinzip der Gleichheit etwas völlig anderes als „Identität“, wie umgekehrt das Recht auf Verschiedenheit nicht mit Ungleichheit verwechselt werden darf. Ohne Frage sind die Menschenrechte voraussetzungslos, und doch bedarf es zu ihrem Schutz eben auch einer Gesellschaftlichkeit, die über bloße humanitäre Gesten hinausgeht. Mit politischen Sonntagsreden ist es nicht getan. In den Menschenrechten steckt mehr als ein moralischer Appell. Mit ihnen verbinden sich auch individuelle Rechtsansprüche und somit gesellschaftliche Verpflichtungen. Nur als Teil rechtlich verfasster Gemeinschaften sichern sich die Menschen ihre Rechte. Nur dort, wo es öffentlich getragene und allen zugängliche Institutionen von Daseinsvorsorge gibt, können Menschen auch ihre sozialen Rechte geltend machen.
Mit der Globalisierung habe das Risiko für soziale Verunsicherung dramatisch zugenommen, müssen die Apologeten des Neoliberalismus inzwischen einräumen. Es ist das Gefühl, keine Rolle mehr zu spielen, nicht mehr teilhaben zu können, das die Unvernunft wachsen lässt und den Rechtspopulisten in aller Welt in die Hände spielt. Wie das Gegengift aussehen könnte, wusste schon Sigmund Freud: er könne nicht einsehen, warum die von uns selbst geschaffenen Einrichtungen nicht vielmehr Schutz und Wohltat für uns alle sein sollten. Bernie Sanders hätte man dieses Programm vermutlich abgenommen.
Eine solche Gesellschaftlichkeit entsteht nicht über Abschottung und Identität und schon gar nicht über den markigen Spruch, eine Nation wieder groß zu machen. Das Recht, Rechte zu haben, von dem Hannah Arendt gesprochen hat, existiert völlig losgelöst von ethnischen, religiösen oder kulturellen Unterschieden. Und es muss auch nicht erst durch willfähriges Verhalten verdient werden. Menschen haben ein Recht auf soziale Sicherung, unabhängig von ihrer Hautfarbe oder davon, ob sie privat vorgesorgt haben. Sie haben ein Recht auf höchstmögliche Gesundheit, ungeachtet ihrer jeweiligen Lebensstile und ungeachtet ihrer individuellen Kaufkraft. Sie haben ein Recht auf Bildung, die ihnen eine kreative Existenz jenseits kulturindustrieller Gleichschaltung ermöglicht. Das ist der Kern solidarisch verfasster Gesellschaften.
Solidarisch abgesicherte Vielfalt
Deutlich wird, dass Vielfalt und Solidarität keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen – mit Blick auf den unterdessen erreichten Globalisierungsgrad längst in globaler Dimension. Aus dem Mitfühlen mit den Fremden, den Flüchtlingen, den Opfern von Kriegen und Not erwächst eine ethische Verpflichtung für die internationale Verabredung von sozialökologischen Normen und schließlich für den Aufbau von Institutionen, die grenzüberschreitend für Umverteilung sorgen und so die Voraussetzung für die Verwirklichung und den Schutz der Menschenrechte schaffen. Die Rettung liegt weder in der Abschottung noch im Identischen, sondern allein in der solidarisch abgesicherten Garantie von Vielfalt.
Mit dem Verlust des göttlichen Mythos sei in der säkularisierten bürgerlichen Welt, so Georg Lukács, eine „transzendentale Obdachlosigkeit“ über die Menschen gekommen. Die damit einhergehenden Verunsicherungen aufzufangen, wird nur gelingen, wenn Menschen in demokratisch verfassten und für Teilhabe und Ausgleich sorgenden Gesellschaften ein neues Dach finden. Das war das Projekt der Moderne: Und eben das steht heute auf dem Spiel.